Blog
Eine wichtige Art der Freiheit

Der Dauer-Lockdown hat mich in meiner Meinung bestätigt, wie wichtig es ist zu reisen. Dass wir nicht zuhause sitzen und versuchen, uns aus der Ferne ein Bild von Land, Leuten und Stimmungen zu machen. Denn so sind wir immer darauf angewiesen, dass uns ein Medium die Bilder und Eindrücke liefert. Dabei ist es wichtig, sich vor Ort sein eigenes Bild zu machen. Während man zwangsweise Monate lang zuhause saß, erreichten einen die Nachrichten über die Lage der anderen Länder und mit anderen Ländern meine ich nicht etwa Länder auf anderen Kontinenten, sondern ich meine unsere Nachbarn in Europa und die Bundesländer unserer Republik. Man wurde überflutet mit Zahlen und Statistiken über die gemeldeten Infektionen und der an und mit Corona Verstorbenen in den jeweiligen Bundesländern und im europäischen Ausland. Man war ständigen Analysen ausgesetzt, warum und weshalb die Lage woanders besser oder schlechter sei, und es entstand das Gefühl als trennten uns auf einmal Welten. Ich wollte mir ein persönliches Bild von der Lage machen, aber aufgrund des Reiseverbots bestand diese Möglichkeit nicht einmal innerhalb Deutschlands.
Für mich ist das Reisen eine wichtige Art von Freiheit und dabei hängt die Freiheit nicht von den Kilometern der Entfernung meines Reiseziels ab. Wichtig ist, das gewohnte Umfeld zu verlassen und dazu muss man nicht ans andere Ende der Welt reisen. Schon innerhalb Deutschlands entdeckt man unterschiedliche Landschaften, andere Gewohnheiten und kulinarische Unterschiede. Wichtig ist es, neue Eindrücke zu gewinnen und somit Abstand zum Alltag zu bekommen und dabei die Möglichkeit wahrzunehmen, Lösungen für Probleme zu erkennen, die einem im Alltagsleben beschäftigen. In den letzten Monaten habe ich erkannt, wie wichtig es ist, durch die Pandemie bedingte Isolierung nicht zu vergessen, dass wir nicht der Mittelpunkt der Welt sind. Mit unseren Ansichten sind wir ein Produkt unserer Umgebung und Herkunft. Das Reisen ermöglicht es uns, durch Begegnungen mit dem Anderen aufgeschlossener Neuem gegenüber zu sein und sich der Gefahr von Vorurteilen eben nicht auszusetzen. Das vereinfacht vieles im Leben.
Reisen stärkt das Selbstbewusstsein und ist für die persönliche Entwicklung nicht unwichtig. Man muss lernen in der Fremde zurechtzukommen. Begegnungen auf Reisen, Entdeckungen, andere Sprachen und Gewohnheiten wirken inspirierend und genau das hat mir gefehlt.
Als ich im Sommer zwei Wochen in Italien verbrachte stellte ich fest, dass sich zu diesem Zeitpunkt das Leben dort mit der Pandemie von dem Leben bei uns mit der Pandemie im täglichen Miteinander nicht unterscheidet. Es war schön zu sehen, dass sich auch ansonsten nichts verändert hat und uns eben keine Welten trennen. Dies persönlich vor Ort feststellen zu können, ist eine der wichtigsten Arten der Freiheiten.
Claudia Lekondra
Die verlorenen "Plings"

Wie hat es letztens jemand so schön ausgedrückt: Es macht pling und die Idee ist da oder es macht plopp und da ist nichts. Ich bin ein kreativer Mensch und daher weiß ich, dass man Ideen nicht erzwingen kann. Leider macht es bei mir in den letzten elf Monaten selten pling und zu oft plopp. Die Überarbeitung meines Romans gestaltet sich als schwierig. Ich habe das Gefühl, mich in meiner kreativen Parallelwelt seit Monaten im Kreis zu drehen. Manchmal erwische ich mich sogar bei dem Gedanken, dass ich nicht mehr raus will, weil es mir auf mein Gemüt schlägt, die geschlossenen Läden, Restaurants, Hotels, Bars, Cafés und Sportstudios zu sehen. Wenn ich beobachte, wie die Leute mit der Maske im Gesicht auf der Straße aneinander vorbei huschen, entsteht bei mir der Eindruck, als nehme man sich mit Maske im Gesicht weniger wahr.
Die Menschen reduzieren sich in den letzten Monaten immer mehr auf ihr Privatleben und das tut einer Gesellschaft nicht gut. Durch die Kontakteinschränkungen und den Mangel der Möglichkeiten am öffentlichen Leben teilzunehmen, ziehen die Menschen sich zurück und leben in ihrer Blase. Es besteht auf Dauer die Gefahr, dass die Solidarität, Toleranz und Empathie verloren gehen. Dabei erscheint es auf den ersten Blick nicht so. Auf die Frage, wie geht es Dir, kommt meist als Antwort: Gut, man habe ja keinen Grund zu klagen. Man sei schließlich gesund und nehme seit Monaten die persönlichen Lebenseinschränkungen gern in Kauf, weil man ja die Alten und Kranken unserer Gesellschaft schützen will. Klingt doch sehr solidarisch. Wenn dann die Aufzählung folgt, was allerdings gerade den Alltag erschwert und belastet, wie zum Beispiel das viel gepriesene Homeoffice oder das Homeschooling und dann zugegeben wird, dass die Existenzängste von Monat zu Monat zunehmen und der Zustand dauerhaft in Stress ausartet, klingt es ehrlich gesagt nicht danach, dass es einem gut geht und man keinen Grund zu klagen hätte. Dennoch folgt dann meistens noch rasch der Zusatz, dass das ja aber alles Jammern auf hohem Niveau sei. Ganz ehrlich, ich kann diesen Ausspruch nicht mehr hören.
Wenn ein Single mir erklärt, dass er es doch ganz gut habe, weil man eben nicht dem Stress mit Kindern im Homeoffice und -schooling ausgesetzt sei und man nicht in die Verlegenheit käme, sich während der Kontakteinschränkungen mit einem Partner allein in den vier Wänden anzuöden, klingt das für mich sehr nach einer Schutzbehauptung, ebenso wenn eine gestresste Mutter mit Kindern im Homeschooling und parallel im Homeoffice mit Ehemann vorgibt, es gehe ihr doch im Verhältnis gut, man sitze schließlich nicht einsam und allein zuhause. Bei all den Äußerungen habe ich das Gefühl, immer so ein „aber“ als Hintergrundrauschen zu vernehmen.
Was ist los mit der Gesellschaft? Es geht natürlich immer auch schlimmer, aber es geht immer auch besser. Es ist ein Trugschluss zu denken, es ginge einem besser, nur weil es anderen noch schlechter gehe. Das funktioniert nicht wirklich. Das sagt der Kopf, aber nicht das Gefühl. Eigentlich wissen wir es doch, dass das Verdrängen von Gefühlen nichts bringt, dass es sogar auf Dauer gefährlich sein kann und die Psyche negativ beeinflusst. Wir müssen gerade, während wir ausgebremst in unserer Blase leben, zugeben dürfen, dass wir leiden, weil wir Dinge vermissen, auch wenn diese Dinge auf den ersten Blick im eigentlichen Sinn nicht überlebenswichtig erscheinen.
Ich habe den Eindruck, je länger diese Ausnahmesituation andauert, umso mehr verliert sich die Gesellschaft. Das Gefühl, dem ganzen machtlos ausgeliefert zu sein, diese Ohnmacht, nimmt von Woche zu Woche zu. Der Austausch findet nur noch oberflächig statt, man stumpft ab, ist dem allem so müde und irgendwann fehlt dann einfach die Kraft für die Solidarität, das Gefühl für die Toleranz und es kommt zu einer falsch verstandenen Empathie.
Mir fehlen die Schwingungen des Alltags. Mir fehlt der öffentliche Raum, dieses Abtauchen in eine andere Atmosphäre. Abtauchen ins Theater, in die Oper, Museen, die Kunst genießen und diesen Genuss, mit anderen Menschen physisch in einem Raum zu teilen. Gerüche und Geräusche wahrnehmen. Im Restaurant sitzen, dem Stimmengewirr, dem Lachen lauschen, dabei den Service und die Speisen genießen und bei alledem den Abstand zu seinem Zuhause und zu sich finden. Mir fehlen die Gespräche, in denen man sich mit seinem Gegenüber verliert und dabei neuen Gedanken und Ideen folgt. Die skurrilen zum Teil blöden, absurden gedanklichen Inspirationen, aus denen ganz wunderbare neue Ideen und Geschichten entstehen. Das funktioniert weder über E-Mail, Chat, Telefonate oder Skype & Co. Auch die Konzert- und Opernübertragungen im Netz oder im Fernsehen können die Atmosphäre der physischen Anwesenheit nicht ersetzen. Das alles fehlt mir so sehr und ich gebe es offen zu: es geht mir nicht gut damit. Es hilft mir eben nicht, dass es gerade einen anderen Menschen in meinem Umfeld vielleicht schlechter geht. Dieser Umstand spricht allenfalls mein Mitgefühl an, ändert aber nichts daran, dass mir die Inspirationen und die Lebendigkeit fehlen, die man auf Dauer in so einem ausgebremsten distanzierten Leben nicht finden kann und dabei gehen die Plings verloren und es bleiben zu viele Plongs.
Claudia Lekondra
Du kannst alles verschieben, nur Dein Leben nicht

Geschafft, das Jahr 2020 haben wir seit ein paar Tagen hinter uns gelassen. Aus, vorbei, Geschichte! Viele konnten den Jahreswechsel kaum erwarten, sie wollten einfach, dass dieses von der Pandemie geprägte Jahr vorbei ist. Auch wenn der Jahreswechsel nur ein Tag ist, verbinden viele mit diesen Tag das Gefühl des Überganges, eine Form des Abschlusses. Es bedarf keinen bestimmten Tag, um einen Abschluss zu finden, aber viele von uns brauchen Rituale. Und es gehört zu den Ritualen, gerade zum Jahreswechsel mit guten Vorsätzen in das neue Jahr zu starten. Natürlich kann man jeden Tag im Jahr mit etwas anfangen und aufhören, aber Rituale geben dem Ganzen eine andere Bedeutung und vielleicht ist gerade dies der Grund, warum man sich diesen Tag aussucht. Dieser Jahreswechsel war von etwas anderem geprägt. Eben nicht von unseren persönlichen Ritualen, sondern davon, dass wir dieses Jahr abschließen wollten.
Dieses Jahr, das global in die Geschichtsbücher eingehen wird, wie kaum ein anderes Jahr in den letzten Jahrzehnten. Wir sehnten den Abschluss herbei, weil wir vorwärtsschauen wollen. Voller Erwartung, Skepsis und Bangen zugleich blicken wir 2021 entgegen. Bei alledem dürfen wir nicht vergessen: es ist unsere Lebenszeit, die weiterläuft, auch während und mit der Pandemie. Wir können nicht auf die Pausetaste drücken und erst wieder weiter machen, wenn wir glauben, dass alles vorbei ist. Also: einatmen, ausatmen, lachen, lieben…die Erde dreht sich weiter.
In diesem Sinne: Happy New Year!
Claudia Lekondra
Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit
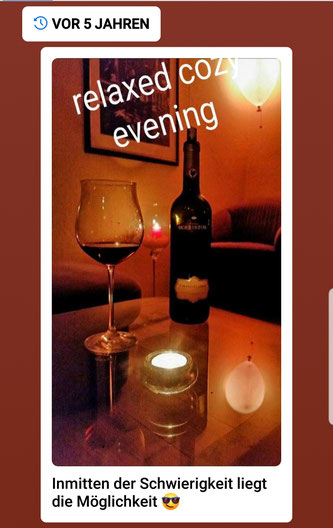
Wartezeit empfinden wir als verlorene Zeit. Das ist der Grund, warum wir mit dem Warten so ungeduldig umgehen. Beim Arzt im Wartezimmer, an der Kasse im Supermarkt, auf dem Bahnsteig, an der Bushaltestelle, auf dem Flughafen. Warten auf einen Anruf, auf einen Bekannten, Freunde oder Geschäftspartner. Bei diesem Warten geht es immer nur um ein paar Minuten, eine halbe Stunde, manchmal ein paar Stunden und vielleicht lässt ein erhoffter Anruf mal einen Tag auf sich warten. Wir mögen das Warten nicht, weil wir das Gefühl haben, nichts dagegen tun zu können, dass wir in dieser Phase fremdbestimmt sind. Wir sind es gewohnt, effizient unser Leben zu organisieren und zu planen. Am Anfang eines Jahres stehen bereits die Urlaubsplanungen, die nächsten vier Wochen sind mitunter freizeitmäßig bereits verplant. Ein erlebnis- und ebenso abwechslungsreiches Leben will eben gut organisiert sein. In so ein Leben passt das Warten nicht.
Wenn wir in den letzten Monaten etwas gelernt haben, dann das Warten. Wir alle warten, dass diese Pandemie ihren Schrecken verliert und die epidemische Gefahr gebannt wird. Hierbei geht es nicht um ein paar Minuten, Stunden, Tagen oder Wochen des Wartens. Wir warten bereits seit Monaten. Immer wieder wird der Gesellschaft eingeredet, dass die mit der Corona Pandemie einhergehenden Einschränkungen auch als Chance, als eine Art Auszeit zu sehen sei, unser Leben zu überdenken. Mal davon abgesehen, dass ich - und sicher auch einige andere - auch ohne eine "Auszeit" durchaus in der Lage bin mein Leben zu überdenken und es genauso gut fand, wie es bisher verlief, stellt vielleicht tatsächlich der einer oder andere derjenigen, die weder einer Risikogruppe angehören, noch vor dem wirtschaftlichen Aus stehen, und nicht einer trostlosen perspektivlosen Zeit entgegen blicken, fest, dass es manches zu entdecken gibt, was man vorher nicht wahrgenommen hat oder man sich eben einfach daran erfreut, dass dem Leben etwas an Tempo genommen wurde. Andere haben vor lauter Sorgen um ihre Existenz kaum die Möglichkeit, in der "Auszeit" etwas Positives zu sehen und fühlen sich mit dieser Art von schlauen Ratschlägen sicher fast schon provoziert.
Die Tage bin ich auf einen Post von mir gestoßen, den ich vor fünf Jahren online gestellt hatte. Auf dem Foto sieht man eine Weinflasche neben einem Glas Wein und Kerzenschein. Es vermittelt einen gemütlichen und kuscheligen Eindruck und ich zitierte dazu Albert Einstein: Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es gewesen war, das mich zu diesem Post hat hinreißen lassen, ob ein Erlebnis oder eine Unterhaltung. Ich bin mir aber sicher, dass ich nicht die Art der Schwierigkeiten gemeint hatte, die uns in den letzten Monaten umgeben und auch die angedachten Möglichkeiten in einem anderen Zusammenhang standen. In den letzten Monaten haben wir vielleicht alle gelernt geduldiger zu sein, wenn auch nicht aus Überzeugung, sondern eher aus mangelnden Alternativen. Also warten wir, obwohl wir darin so verdammt schlecht sind. Vielleicht ist das die Möglichkeit inmitten der Schwierigkeit.
Claudia Lekondra
Himmel über Berlin

So, das war es. Der letzte offizielle Flieger hat den Flughafen Tegel Richtung Paris verlassen. Somit ist der Flughafen Tegel mit acht Jahren Verspätung nun Geschichte. Man erinnert sich: Es war eigentlich bereits im Jahre 2012 geplant, vom neuen Flughafen Berlin Brandenburg zu starten. In den Jahren danach hatte ich irgendwann aufgehört, mir die jeweils geplanten Eröffnungstermine des neuen Flughafens zu merken, da diese ja eh immer wieder verschoben wurden. Fast hätte ich so die tatsächliche Eröffnung des neuen Flughafens verpasst. Covid19 hat dafür gesorgt, dass wir uns in diesem Jahr von einigen Gewohnheiten vorübergehend oder auch für immer verabschieden mussten, da passt doch der Abschied vom Flughafen Berlin-Tegel prima in dieses Jahr. Viele Berliner nutzten die letzten Tage, sich von dem Flughafen zu verabschieden.
Auch ich drehte meine letzte Runde im Terminal A. Es ist doch nur ein Flughafen wird da der ein oder andere, gerade unter den Jüngeren der Stadtbewohner, denken. Es war mehr als ein Flughafen, das ist und war der Geschichte der Stadt geschuldet. In den Jahren der Teilung Berlins war der Flughafen Tegel das Tor zur Welt. Während man auf dem Landweg den Westteil der Stadt mit Bahn und Auto nur über die Transitstrecke verlassen konnte und so den nervigen zeitintensiven Grenzkontrollen und mit dem Auto außerdem den Geschwindigkeitsbeschränkungen und dem holprigen Asphalt der Transitstrecke ausgesetzt war, setzte man sich einfach in einen Flieger und hob ab in die Freiheit. Hierbei waren zwar die ersten 15 Minuten eines Fluges etwas ruckelig, was an der vorgegebenen Reiseflughöhe (maximal 10.000 Fuß) innerhalb der Luftkorridore lag, über die man von Berlin-West das Gebiet der damaligen Sowjetischen Besatzungszone überflog. Hatte man erst einmal den Luftkorridor passiert, stieg der Flieger auf zur Reiseflughöhe und der entspannte Teil der Reise begann. In den ersten Jahren gab es für die Berliner nur die Möglichkeit, ihre Urlaubsziele über andere deutsche Städte zu erreichen, da Direktflüge von Berlin aus in Urlaubsregionen nicht angeboten wurden. Das änderte sich, als unter anderem DAN AIR, PAN AM und die damals neugegründete Air Berlin USA sogenannte Charterflüge anboten und nun die Berliner direkt in ihre Urlaubsregionen flogen. Alle erwähnten Airlines sind ebenso Geschichte, wie nun auch der Flughafen.
Wie viele andere Reisenden schätzte ich die kurzen Wege des Flughafens Tegel. Ich empfand es immer als praktisch, dass sich dort, wo man eincheckte auch die Pass- und Sicherheitskontrolle befand und wenn man diese passierte, ließ man sich auf einen der direkt dahinter vorhandenen Plätze nieder und wartete auf sein Boarding. Kurze Wege halt. Man hatte die Möglichkeit, sich lang und intensiv direkt am Gate zu verabschieden, eben weil man von dort aus die Warteschlange des Sicherheitsbereichs im Blick hatte und genau abschätzen konnte, wann es tatsächlich erforderlich war, sich endgültig zu verabschieden, um das Boarding nicht zu verpassen. Bei der Ankunft konnte man den Ankommenden bereits zu winken und vor dem Gate durch eine Trennscheibe beobachten, wie geduldig darauf gewartet wurde, dass sich das Gepäckband in Bewegung setzte. Praktisch war es nicht möglich, sich auf dem Flughafen zu verlaufen, man umrundete ihn einfach und kam irgendwann genau da an, wo man hinwollte. Das änderte sich etwas, als der Flughafen mehr und mehr an seine Kapazitätsgrenze kam und man aus der Not heraus weitere behelfsmäßige Terminals errichtete.
Der Flughafen, der ursprünglich für ein Fluggastaufkommen von sechs Millionen ausgerichtet war, fertigte im Jahre 2019 24 Millionen Fluggäste ab und platzierte sich so, gemessen am Fluggastaufkommen, auf Position vier der größten Flughäfen Deutschlands. Über die Jahre wurde es immer enger und hektischer und durch die Vernachlässigung des Flughafens, was Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten anging, war der Lack ab und zum Vorschein kam ein ungepflegtes Äußeres, das sicher den einen oder anderen Berlin-Besucher irritierte. In einer touristisch orientierten Stadt wie Berlin passte ein derartig veralteter Provinzflughafen nicht. So sahen es sicher die objektiven Betrachter des Flughafens Tegel, die anderen übersahen das alles. Klein, eng, praktisch, vertraut und irgendwie immer wieder schön in seiner Einzigartigkeit. Und alles funktionierte! Dafür sorgten die Mitarbeiter, das Herz und die Seele des Flughafens. Ihrer grandiosen Leistungen unter den zunehmenden erschwerten Bedingungen des erhöhten Passagieraufkommens auf engsten Raum, war es zu verdanken, dass alles lief, dass man auf Jahrzehnte unfallfreien Flugbetrieb zurückblicken kann.
Warum so viele Worte für einen Flughafen? Weil mich dieses wehmütige nostalgische Gefühl übermannte, als ich am Wochenende meine Abschiedsrunde drehte. Durch Covid19 erinnerte dieser Tage nichts mehr an die Betriebsamkeit der letzten Jahre. Die Anzeigetafel der Ankünfte und Abflüge war nicht einmal zu einem Drittel ausgefüllt, vor den Gates bildeten sich keine unübersichtlichen Schlangen, niemand kämpfte sich hektisch einen Weg durch die Menschenmassen. Dieser in die Jahre gekommene Flughafen führte einen in den letzten Jahren deutlich vor Augen, wie sich seit den siebziger Jahren die Welt und damit verbunden die Fluggewohnheiten der Menschen verändert haben, eben weil er ursprünglich für eine andere Zahl von Passagieren ausgerichtet war. Entfernungen existieren eigentlich nicht mehr, wir steigen einfach in den Flieger und überwinden mal locker nur für ein verlängertes Wochenende 2000 Kilometer in zweieinhalb Stunden und das nicht nur einmal im Jahr, sondern mehrmals und über mitunter größere Distanzen. Längst existieren in den großen Städten dieser Welt nur noch Flughäfen anderer Größenordnungen, denen allen in diesem Jahr die Passagiere fehlen, von daher, wäre der Flughafen-Tegel von der Größe her betrachtet dieser Tage wieder mehr als ausreichend. Die Welt dreht sich weiter und es wird eine Reisezeit nach Covid19 geben. Abschied und Wehmut bedeuten nicht, dass man nicht offen ist für Neues. Auf meinen ersten Abflug vom Flughafen Berlin-Brandenburg freue ich mich einfach mal schon und dem Tegel Projekt GmbH sehe ich mit Spannung entgegen. Die Baupläne sehen vor, dass das Gebäude des bisherigen Terminals A erhalten bleibt und so wird dem Flughafen ein Denkmal geschaffen, während es am Himmel über Berlin nun still wird.
Claudia Lekondra
Gedanken zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit

COVID 19 beherrscht seit Monaten unser Leben, wirft seine Schatten und stellt viele andere Ereignisse in den Hintergrund. Die ersten Ermüdungserscheinungen zum Thema Pandemie machen sich in der Bevölkerung breit, man ist dem Dauer-Alarmismus überdrüssig. Man will nicht mehr stumpf auf Zahlen starren, die mehr Fragen aufwerfen, als es Antworten gibt. Also wendet man sich dieser Tage doch gern anderen Ereignissen zu. Wie wäre es zum Beispiel mit dem 30. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands! Historisch korrekt ausgedrückt: Vor 30 Jahren trat die DDR der Bundesrepublik Deutschland bei. Und wenn wir schon bei dem Thema korrekt ausdrücken sind: Gesetzlich formuliert, vor 30 Jahren am 03. Oktober erfolgte die Herstellung der Einheit Deutschlands. In unseren Kalendern ist hierzu als Feiertag Tag der Deutschen Einheit vermerkt. Aber wie wir ihn auch immer bezeichnen wollen, es geht an diesem Tag darum, sich zu erinnern. Zum Beispiel daran, welche Hürden seinerzeit genommen werden mussten, um das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Denn mit der „Wiedervereinigung“ Deutschlands war lediglich die Grundlage dafür geschaffen, dass wieder zusammenwächst, was zusammengehört. Dazu musste zunächst das entfernt werden, was das Land über Jahrzehnte am augenscheinlichsten trennte. Die Mauer!
Bereits im Juni 1990 wurde mit dem Abbau der innerstädtischen Mauer in Berlin begonnen. Die Grenztruppen der DDR, die bisher die Mauer bewachten, hatten nun die Aufgabe, diese zu zerstören. Jene Mauer, die sie sogar unter Einsatz von Schusswaffen gegen „Grenzverletzer“ bisher zu schützen hatten. Welch Ironie! 184 km Mauer, 153 km Grenzzaun, 144 Signalanlagen und 87 km Sperrgraben waren allein in Berlin abzubauen. Ein Aufwand, der die Grenztruppen vom Umfang her überforderte, so dass sie seitens der alliierten Schutzmächte, von den Pionieren der Bundeswehr sowie von Bauunternehmen Unterstützung erhielten. Bereits Ende November 1990 war die „Mauer“ in Berlin verschwunden. Übrig blieben lediglich Abschnitte der Grenzmauer, zum Gedenken an die Teilung der Stadt und viele kleine Mauersteine, die man in dem einen oder anderen Privathaushalt findet. Auch ich besitze so ein Mauerstück, das ich seinerzeit persönlich an der Grenze einsammelte. Der Abbau der gesamten ehemaligen innerdeutschen Grenzen dauerte noch bis Mitte der 90er Jahre an. Rückblickend gesehen, gehörte das Entfernen der Mauer als Trennungsmerkmal zu den doch eher einfacheren Aufgaben, was das Zusammenwachsen des Landes betraf.
Auf dem ehemaligen sogenannten Todesstreifen stehen längst Häuser und deren Bewohner verschwenden sicher heutzutage kaum noch einen Gedanken daran, dass ihr schöner Garten vor 30 Jahren zu einer Grenzanlage gehörte. Und das ist normal, so ist das Leben, es geht weiter. Das ist Geschichte. So wird auch unser Heute, mit all den Corona bedingten Einschränkungen, in Zukunft Geschichte sein und so wie wir heutzutage rückblickend auf den Prozess der Wiedervereinigung erkennen, dass wir mit dem Wissen von heute einiges anders gemacht hätten, werden wir in der Zukunft auch rückblickend erkennen, was im Umgang mit der Pandemie hätte besser gemacht werden können. Welche Einschränkungen nicht gerechtfertigt waren, wo man früher oder anders hätte reagieren sollen. Die aktuellen Einschränkungen verbunden mit den täglichen Meldungen der Zahlen der Corona-Infizierten, machen mir nicht nur den Verlauf der innerdeutschen Bundesgrenzen, sondern auch den Grenzverlauf zu den Nachbarländern wieder sichtbar und lösen in mir ein gruseliges Gefühl eines Déjà Vu aus. Gedenken wir also den 30. Jahrestag der Einheit Deutschland und lassen den 3. Oktober aus den COVID 19-Schatten treten.
Claudia Lekondra
Gesichtslose Zeiten

Auf den ersten Blick glaubt man, alles ist wie immer. In Berlin bewegen sich die Autos, Busse und alles, was sonst so auf den Straßen unterwegs ist, wieder von einem Stau in den nächsten. Die Menschen hetzen wieder aneinander vorbei, Sicherheitsabstand ade. Aber es sind kaum Touristen in der Stadt und wenn man abends und nachts unterwegs ist, fehlt das Leben und der Trubel, da alle kulturellen Einrichtungen sowie die Clubs dieser Stadt nach wie vor noch geschlossen sind. Das macht sich allerdings nur in den späteren Stunden des Tages besonders bemerkbar.
Und dann begegnet man im Laden, in der U-Bahn oder im Bus all diesen Gesichtslosen. Spätestens dann wird einem klar, dass eben nichts wie immer ist. Der Mund- und Nasenschutz erinnert uns an die unsichtbare Bedrohung und daran, dass jeder von uns eine potenzielle Virenschleuder sein könnte. Wir verlieren im wahrsten Sinne des Wortes unser Gesicht hinter dem Mund- und Nasenschutz. Es ist nicht mehr möglich, im Gesichtsausdruck des anderen zu lesen und somit habe ich das Gefühl, dass unsere Kommunikation nachhaltig gestört ist, während wir uns hinter diesem Schutz verstecken müssen.
Ich bin es gewohnt, an dem Zusammenspiel zwischen Mund und Augen im Gesicht des anderen zu lesen. Daran mache ich aus, wie es dem anderen geht, was er fühlt. Im Supermarkt bin ich sogar schon mal an einer Bekannten zunächst grußlos vorbei gegangen, weil ich sie mit dem Stoff im Gesicht nicht wahrgenommen hatte und die Kommunikation beschränkte sich auf das Wesentliche, da es nicht immer einfach zu verstehen ist, was der andere da gerade in seine „Abdeckung“ spricht. Dieses „Verstecken“ hinter dem Stoff ist für manche auch praktisch. Begeistert wurde mir hierzu berichtet, dass man der einen oder anderen Begegnung absichtlich elegant aus dem Weg gehen kann. Nun gut, dieses Verhalten würde ich jetzt einfach mal als gestörte Kommunikation bezeichnen.
Und dass wir in den letzten Monaten mal schnell und unkompliziert unserer Grundrechte beschnitten wurden und dass auch die Sache mit dem Datenschutz nicht mehr ganz so eng gesehen wird, so lange man alles mit dem Versuch der Eindämmung der Pandemie begründen kann, ist ja nun das eine, aber dass den „Schlingeln“ unserer Gesellschaft so manches vereinfacht wird, ist das andere. Ich empfinde es schon etwas beunruhigend, wenn ich am Eingang zu den Bankfilialen aufgefordert werde, meinen Mund- und Nasenschutz aufzusetzen, selbst wenn ich mich nur zu einem der Geldautomaten begeben möchte. Wirklich prima. Wenn man etwas im Schilde führt, kann man sich jetzt dem Opfer völlig unkompliziert nähern. Das war früher schwieriger. Da ist man halt einfach aufgefallen, wenn man eine Bankfilialen mit Maske betrat. Jetzt kann man sich sogar zum Schein erst einmal brav in der Schlange einordnen und dann, so als Überraschungsmoment, zum Überfall blasen und man bleibt dabei unerkannt. Auch die Überwachungskameras an den Geldautomaten lassen einen kalt. Am helllichten Tag hebt man jetzt einfach mit fremden (zuvor entwendeten) Karten Geld ab. Zwischen all den anderen „Maskierten“ fällt man ja nicht mehr auf und man muss nicht im Schutz der Dunkelheit in den Vorraum der Bankfilialen mit einer Mütze ins Gesicht gezogen huschen. Echt prima. Auch so ein Taschendiebstahl, Einbruch etc. lässt sich mit dem Mund -und Nasenschutz um einiges einfacher bewerkstelligen. Man wird nicht stutzig, wenn die eine oder andere Person auch auf der Straße den Mund- und Nasenschutz trägt. Man vermutet hier einen besonders ängstlichen Menschen dahinter oder einen, der einfach keine Lust hat, ständig den Schutz auf und ab zu setzen. Na egal, wir haben ja gerade andere Probleme in unserer gesichtslosen Zeit und auf den ersten Blick ist ja schließlich alles wie immer.
Claudia Lekondra
Was fehlt wirklich in diesen Tagen

Zu Beginn des Shutdowns fühlte es sich für mich an, als ziehe man mir den Boden unter den Füßen weg. Mein so vertrautes Leben in dieser Welt war mir auf einmal fremd. Ohne Vorwarnung von einem Tag auf den anderen war das bunte Leben einfach verschwunden. Die gewohnte Abwechslung des Alltags wich der Eintönigkeit eines Lebens, das man nicht freiwillig gewählt hat.
Von einen Tag auf den anderen war man fremdbestimmt. Ein Albtraum wurde wahr. Mit eines der höchsten Güter meines Lebens, nämlich meine Freiheit, war über Nacht abhandengekommen.
Die Menschen, die mir gegenüber erklärten, ihr Leben würde sich mit dem Shutdown, bis auf den Mangel an Toilettenpapier und Mehl, nicht sonderlich von ihrem sonstigen Alltag unterscheiden, empfinden die Sache mit der Freiheit sicher anders. Aber eben das ist Freiheit, dass jeder frei wählen kann, wie er lebt. Während diejenigen, die ihr Leben mit und ohne Covid19 gleich leben, habe ich unter den für mich einschneidenden Veränderungen einen Weg gefunden, mir es mit den momentanen Möglichkeiten in meinem Leben wenigstens etwas bunt zu gestalten.
Die Restaurantbesuche finden nun zuhause statt. Entweder versucht man sich an dem einen oder anderen neuen Rezept oder es wird bei einem der Lieblingsrestaurants bestellt. Während man die einem so vertrauten Lieblingsspeisen dann in seinen eigenen vier Wänden genießt, träumt man sich mit der entsprechenden musikalischen Untermalung davon. Die sportlichen Aktivitäten werden entweder ins heimische Wohnzimmer oder unter freien Himmel verlagert. Das schöne Wetter genießt man nun bei einem ausgiebigen Spaziergang und entdeckt hierbei immer wieder neuen Ecken in seiner Umgebung und der Fernseher bekommt im wahrsten Sinne des Wortes einen neuen Unterhaltungswert, indem er unter anderem als Ersatz für die Theater- und Konzertbühne herhalten muss. Das soziale Netzwerk und die Technik sorgen dafür, dass wir mit Familie, Freunden und Bekannten trotz physischer Kontaktsperre in Kontakt bleiben.
Noch immer ist mir dieses Leben fremd, aber der Boden unter meinen Füßen fühlt sich etwas stabiler an. Die Schockstarre löst sich etwas und ich bin nun in der Lage, mich zu fragen: Wen vermisse ich wirklich in diesen Tagen? Was von alle dem, was sonst meinen Alltag prägt, trägt wirklich dazu bei, dass sich mein Leben bunt anfühlt? Was entdecke ich in diesen Tagen wieder oder neu? Was gehört dazu, was vielleicht in Vergessenheit geraten ist oder bisher keine große Beachtung gefunden hat? Welche Menschen oder Begegnungen sind einen in diesen Tagen wichtig? Während ich sehnsüchtig darauf warte, meine Freiheit zurückzuerhalten ist es Zeit für die Frage: Was fehlt wirklich in diesen Tagen?
Claudia Lekondra
Stillstand

Heute wurden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt und wie immer stellt sich der eine oder andere wieder die Frage: Vor oder zurück? In den sozialen Medien habe ich heute hierzu gelesen:
„Die Uhren werden umgestellt. Keine Ahnung in welche Richtung, aber ich hoffe zwei Monate vor.“
In Zeiten wie diesen richten wir alle hoffnungsvoll unseren Blick in die Zukunft. In einer Zeit, wo man sich als Mensch auf ein Virenüberträger reduziert fühlt und ein Treffen mit Familie und Freunden als Infektionsstätte gilt. Eine Zeit des wirtschaftlichen Stillstandes und Beschneidung unserer Grundrechte. Welche Entscheidungen richtig oder falsch sind, ob hier die Verhältnismäßigkeiten gewahrt werden und das Augenmaß immer richtig ist, lässt sich heute nicht beurteilen. Die Antwort hierzu gibt es vielleicht in zwei Monaten. Bis dahin sind wir gezwungen, unsere Routinen zu unterbrechen und uns der Zwangsentschleunigung hinzugeben. Während wir beobachten, wie Menschen aus der Not heraus Kreativität entfalten und daraus sich zum Teil neue Geschäftsideen (und seien es auch nur vorübergehend brauchbare Ideen) ergeben, hilft es uns sicher, den Optimismus zu bewahren. Unsere Erde hat gerade Ferien und genießt den Stillstand und wir, wir machen es uns Zuhause gemütlich, halten uns brav an das Kontaktverbot und glauben ganz fest daran, dass wir so dazu beitragen Menschenleben zu retten.
Claudia Lekondra
Ehrlich mit der Wahrheit

Mit der Wahrheit ist das so eine Sache. Man begegnet diesem Begriff in seiner frühesten Kindheit. Es sind meistens die Eltern, die einen dazu anhalten, immer die Wahrheit zu sagen. Die einem versuchen klarzumachen, dass es wichtig ist, immer ehrlich zu sein. Als Kind war die Welt noch etwas überschaubarer und daher glaubte man zunächst zu verstehen, was die Wahrheit ist. Man sagte eben nicht die Wahrheit, wenn man auf die Frage, ob man den letzten Schokoriegel gegessen habe, den ein anderes Familienmitglied sich extra zurückgelegt hatte, „nein“ antwortete und inständig hoffte, dass da keine verräterischen Spuren am Mund zurückgeblieben waren, die einen der Lüge überführten. Schwieriger wurde es, wenn man bei einer Familienfeier auf Tante Erna traf, die mal wieder ein Kleid mit einem undefinierbaren Muster trug und man in seiner erfrischenden direkten Art eines Kindes nicht gerade in gedämpfter Lautstärke seiner Mutter erklärte, dass das Muster doch sehr merkwürdig sei und hässlich aussehe. Auf das „Psst, nicht so laut“ der Mutter reagierte man dann noch besonders empört und erklärte dann in einer zwar nun eher gemäßigten, aber dennoch in einer für alle vernehmbaren Lautstärke: „Das sagst Du doch auch immer über Tante Ernas Kleider“. Ein paar Jahre später versteht man, warum die Mutter damals besonders verhalten und peinlich berührt auf diese Aussage mit „Psst, nicht so laut“, reagierte, wenn uns nämlich bewusst wird, dass Tante Erna seinerzeit besonders stolz über ihre selbstentworfenen Kleider war und glaubte, sich in den Anfängen der Kariere einer großen Designerin zu sehen. Solche Momente ließen uns damals erahnen, dass die Sache mit der Wahrheit nicht so einfach sein kann, wie es unsere Eltern versuchten uns zu vermitteln.
Wir sollen immer die Wahrheit sagen? Aber wir können nicht immer die Wahrheit sagen, es sei denn wir wollen einsam und verlassen in dieser Gesellschaft vor uns hinleben. Wir können nicht immer sagen, was wir denken, weil wir in gewissen Situationen anderen damit vor den Kopf stoßen würden. Wir können auch nicht immer sagen, was wir fühlen, weil wir damit mitunter komplizierte zwischenmenschliche Verwicklungen auslösen könnten. Wir begreifen dann irgendwann, dass wir persönlich entscheiden müssen, was andere unbedingt wissen müssen und wie wir etwas formulieren, um die sozialen Beziehungen jeder Art eben nicht zu gefährden. Wir verstehen dann auch schnell, dass Wahrheit etwas mit Ehrlichkeit zu tun hat. Und nun mal ehrlich: Wollen wir immer unbedingt wissen, was andere über uns denken oder was andere tun? Nein, wollen wir nicht. Niemand von uns hört gern, dass sein Gegenüber einen unsympathisch findet, dass das Essen, das man mit viel Aufwand und Mühe gekocht hat, dem Bekochten nicht schmeckt oder dass eine Freundin unsere Lieblingsbluse, die wir gerade tragen, ganz schrecklich findet. Man will nicht hören, dass man dicker geworden ist und mit Anfang 30 will man nicht hören, dass einen die meisten auf Mitte 30 schätzen. Also wollen wir manchmal belogen werden? Ist es denn schon eine Lüge und somit die Unwahrheit und unehrlich, wenn wir manchmal Dinge und Empfindungen einfach unerwähnt lassen? Ist es erst unwahr, wenn wir etwas aussprechen? Oder ist es erst unwahr, wenn wir etwas anders darstellen, als wir es in der Realität empfunden haben?
Und schon wären wir bei dem nächsten Problem mit der Wahrheit und Ehrlichkeit. Jeder empfindet und erlebt Situationen, Gesagtes und Gestiken anders. Es gibt unterschiedliche Blickwinkel auf ein und dieselbe Situation. Bei der Auswertung von Zeugenaussagen kommt man da schnell an seine Grenzen, wenn man als Außenstehender zu entscheiden hat, welche Aussage hier der „Wahrheit“ am nächsten kommt. Denn einmal abgesehen von jenen Zeugen, die zum Schutz ihrer eigenen Person und zum Schutz von anderen tatsächlich vorsätzlich lügen, sind da noch die anderen Aussagen jener Zeugen, die hundertprozentig davon überzeugt sind, dass sich die Situation genau so abgespielt hat, aber leider übereinstimmen eben die Darstellungen mehrerer Zeugen zu ein und derselben Situation nicht immer, eben wegen der Sache mit der persönlichen Wahrnehmung. Sagt jemand deswegen nun die Unwahrheit? Es ist eben schwierig, die Wahrheit anderer einzuschätzen oder zu bewerten.
Vielleicht fangen wir einfach mal bei uns an. Versuchen wir doch mit uns ehrlich zu sein und uns mit unserer eigenen Wahrheit auseinander zu setzen. In dem Spiegel uns in die Augen schauen und für uns feststellen, dass ist die Wahrheit. Manchmal ist es hart, mit sich so ehrlich zu sein, manchmal geraten wir mit unserer Lebensphilosophie ins Wanken. Aber manchmal bringt uns die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber auch einen großen Schritt weiter und vielleicht ist genau das der Weg zur Wahrheit.
Claudia Lekondra
Ist schon alles erzählt?

Im Januar 2016 ging mein erster Blogbeitrag online: „Wir haben nur drei Sekunden für die Gegenwart“, lautete die Überschrift. Es ging in diesem Beitrag darum, dass wir zum Jahreswechsel glauben wahrzunehmen, dass das vergangene Jahr mal wieder so schnell vorübergezogen ist. Seit vier Jahren schreibe ich monatlich einen Blogbeitrag. Die Idee hierzu kam von einer PR-Beraterin. Man würde auf diesem Weg mehr Leute erreichen und so neue Leser dazu gewinnen. Nebenher unterhalte man monatlich seine Fangemeinde, während man an seinem neuen Roman arbeitete. Also setzte ich die Idee in die Tat um und startete im Januar 2016 meinen Blog. 48 Beiträge habe ich bisher verfasst. Ich schrieb unter anderem über Liebe, Leidenschaft, Freundschaft, Glück, Komfortzone, Stress, Kreativität, Vorurteile, Gewohnheiten, Krieg, Selbstreflexion, Ängste und Momentaufnahmen. Ich teilte meine Gedanken zum Altwerden, über Sitte und Bräuche, über unsere unterschiedlichen Rollen im Leben, darüber wo eine offene Gesellschaft endet, übers Müssen und Wollen, über die Dankbarkeit als Gegenmittel für negative Gedanken und ich stellte fest, dass Männer romantisch sind. Und da war noch unter anderem die Geschichte über das kleine Mädchen in der S-Bahn oder dem Obdachlosen und der Tasse Kaffee. In meinen Januarblogbeiträgen der letzten Jahre ging es unter anderem um Vorsätze und dem Motto: Ich habe den Vorsatz, keine Vorsätze für ein neues Jahr zu fassen. Thema war unter anderem auch die verkaterte Stimmung im Januar, die nicht dem Alkohol geschuldet ist, die freudige Erwartung, was das neue Jahr einem so bringen wird und was einem von dem vergangenen Jahr in ein paar Jahren noch gegenwärtig sein wird, an welche Details wir uns erinnern. Und nun ist wieder Januar, der 49. Blog wartete darauf, verfasst zu werden und ich fragte mich: Worüber möchte ich schreiben? Wird es 2020 weiterhin meine monatlichen Blogbeiträge geben? Ist schon alles erzählt? Soll ich wieder etwas über den Januar und das bevorstehende Jahr schreiben? 48 Blogbeiträge und eine zunehmende Lesergemeinschaft, sind doch einfach mal ein paar Zeilen wert, oder? Vielleicht sollte man mal wieder den einen oder anderen Beitrag der letzten Jahre lesen. Wie wäre es zum Beispiel mit „Auf dem Weg zur Selbstreflexion“ vom Februar 2016. Da geht es darum, wie wir mit der Selbstreflexion im Alltag umgehen (hier der Link: https://www.henkeverlag-berlin.de/2016/02/02/auf-dem-weg-zur-selbstreflexion/). Ich versuche auch nach vier Jahren nach wie vor meinen Tag zu reflektieren. Mal gelingt es mir, mal nicht. Aber ich bleibe dran. Happy 2020!
Claudia Lekondra
Zeichen der Zeit

Beim Bummel durch einer mir seit Jahren vertrauten Straße unserer Stadt, etwas abgelegen von den Hotspots, stimmten mich die Hinweisschilder dreier Läden nachdenklich. Ein Handtaschen- und Lederwarenladen schließt nach 60 Jahren. Die Besitzer gehen in Rente und es findet sich kein Nachfolger. Eine Damenboutique macht nach 40 Jahren Schluss und ein weiteres Bekleidungsgeschäft schließt ebenfalls. Was wird nun kommen? Was ist überhaupt noch an Läden im Einzelhandel in Geschäftsstraßen mitten in einer Wohngegend gefragt, in einer Zeit, in der die meisten ihre Bekleidung, Bücher, Technik etc. über das Internet bestellen? Und wenn man mal altmodisch bummeln geht, dann doch eher dort, wo man Einkaufszentren und Kaufhäuser findet. Die gut sortierten Supermärkte mit ihren Frischetheken haben bereits vor Jahren dafür gesorgt, dass viele Fleischereien, Feinkost- oder Gemüseläden aus unserem Straßenbild verschwunden sind. Stattdessen findet man in jener Straße drei Läden, in denen sich jeweils ein anderer Mobilfunkanbieter präsentiert und man fragt sich, ob diese Art Läden in einer Straße mitten in einer Wohngegend sinnvoll erscheinen. Neben der drei Mobilfunkanbieter erfreut man sich dort unter anderem an vier Apotheken, drei Optikern, drei Nagelstudios und immerhin drei Bäckereien. Von Vielfalt im eigentlichen Sinn, kann hier nicht die Rede sein.
Doch wollen wir nicht klagen. Diese Entwicklung haben wir, die Konsumenten und Kunden zu verantworten. In einer Zeit, in der wir es vorziehen, alles bequem am heimischen Computer online zu bestellen und wenn wir einkaufen gehen, es gern alles in einem Laden beieinanderhaben. Diese Gewohnheit lässt halt keinen Raum für den Einzelhandel in einer Wohngegend. Das sind die Zeichen der Zeit. Wir können es hinnehmen oder unser Kaufverhalten ändern. Jammern und klagen hilft hierbei nicht. Auch im Hinblick auf die derzeit allgegenwärtige Diskussion des Klimawandels, stehen wir in der Verantwortung daran etwas zu ändern. Wollen wir die Straßen weiter mit den Lieferfahrzeugen der Paketdienste verstopfen und immense Verpackungsmaterialen in Umlauf schicken? Diese Frage muss jeder für sich persönlich beantworten. Auf die Straße gehen und sich für unser Klima stark machen ist die eine Sache, sein Konsumverhalten der Umwelt zu liebe zu ändern ist die andere und erfordert mehr Nachhaltigkeit. In diesem Sinne: Fröhliche Weihnachten!
Claudia Lekondra
Ost und West, das ist doch nur eine Himmelsrichtung -Teil IV Grenzenlos

Nun ist der 9. November 2019 bereits Geschichte. 30 Jahre sind vergangen, seit jenem Tag, an dem die Mauer durchlässig wurde. Anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahrestag befand ich mich am Potsdamer Platz. Und während ich dort das bunte Treiben beobachtete, versuchte ich mich daran zu erinnern, wie es dort vor 30 Jahren ausgesehen hatte. Mit der Teilung des Landes und dem Mauerbau fristete der Potsdamer Platz für Jahrzehnte ein trauriges Dasein. Ein Brachland, auf beiden Seiten Berlins. Der Potsdamer Platz ist somit ein Ort der Gemeinsamkeit während der Zeit der Teilung zwischen Ost und West. Heute erinnert nichts mehr an jene trostlose Zeit. Mit dem Fall der Mauer kehrte das Leben an diesen Platz zurück. Zunächst verwandelte sich das einzige Brachland in mitten der Stadt zur größten innerstädtischen Baustelle Europas und beeindruckt verfolgte ich über Jahre, was dort gebaut und gebuddelt wurde.
Irgendwann war dann endlich Schluss mit dem Buddeln und Bauen und der Platz war fertig. Ein Stück Berlin war entstanden, das in den Jahren der Teilung weder im Ost- noch im Westteil existiert hatte. Ein Stück Berlin, dass für alle Berliner neu war. Anfänglich tat ich mich schwer mit diesem Platz, seiner Anordnung und den Gebäuden. Zwischenzeitlich ist er mir vertraut und er gehört für mich zu dieser Stadt. Der Potsdamer Platz ist für mich ein Symbol des Zusammenwachsens der Stadt. Die Welt hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert und wir haben uns mit ihr verändert. Mich irritieren immer wieder die Aussagen jener Leute, die alles in Ost und West, hier und drüben teilen. Die gern und möglichst oft versuchen, alle Klischees und Vorurteile in diesem Zusammenhang zu bedienen. Die Worte wie Ostalgie erfinden, wobei es doch längst ein Wort dafür gibt: Nostalgie. Es ist nichts weiter als die Sehnsucht nach etwas, was einem vertraut ist. Wir alle schwelgen ab und an nostalgisch in unseren Kindheits- und Jugenderinnerungen…damals war es. Wir alle nehmen etwas aus dem Damals mit. So selbstverständlich auch jene unter uns, die im ehemaligen Ostteil des Landes bis zum Mauerfall lebten. Es gab ein Leben davor, mit allen Höhen und Tiefen, Freuden, Erfolgen und Misserfolgen, das alles löst sich doch nicht auf, nur weil die DDR nicht mehr existiert. Auch sind die Menschen, die in der ehemaligen DDR ihren Beitrag in der Arbeitswelt geleistet hatten, nicht weniger Wert. Deren Empfinden, ihre Leistung wurde nicht gewürdigt, kann und sollte nur den Irrungen und Wirrungen der Wendezeiten geschuldet sein und heute keinen Bestand mehr haben.
Kritik an Systemen zu üben ist einfach. In der Revolution will man etwas wegfegen. Man weiß nur, was man nicht haben will, aber nicht, was dafür entstehen soll. So war es wohl auch in der Revolution in der DDR. Die Mehrheit der Bürger in der DDR waren sich darin einig, die alte Elite der DDR nicht mehr in den Führungspositionen haben zu wollen und die Mehrheit von ihnen wollte den Wohlstand. An die Veränderung der eigenen Biografie in diesem Zusammenhang und deren Folgen hatte man vermutlich dabei nicht gedacht. Wo etwas geht, kommt was Neues. Wir sind alle gefordert, nicht nur die Politik, sondern auch die Gesellschaft. Es war für alle das erste Mal. Es hat es in der Geschichte noch nie gegeben, dass ein Staat einem anderen Staat aus einem anderen politischen System beitritt. Es kommt darauf an, die Gemeinsamkeiten zu betonen, anstatt die Unterschiede zu suchen, die man glaubt wahrzunehmen, meinte ein Kieler Student und sprach aus, was ich so oft denke. Man sollte auch nicht vergessen, dass die Folgen der Teilung zu bewältigen waren und nicht die Folgen der Wiedervereinigung. Ich bin glücklich und froh über all die Menschen, die seit dem Fall der Mauer in mein Leben spaziert sind. Denen ich nie begegnet wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, weil wir uns hätten nicht begegnen dürfen.
Und gedenken wir die Tage alle denen, denen es nicht vergönnt war, ein unauffälliges Leben in der DDR zu leben, denen es nicht vergönnt war, das Recht der freien politischen Meinungsäußerung unbeschadet auszuüben, die zum Beispiel den Wechsel der Stadtgrenze von Berlin Friedrichshain nach Berlin Kreuzberg vor über 30 Jahren noch mit ihrem Leben bezahlen mussten.
Und heute, heute bewegen wir uns in unserem Land von Ost nach West, von Nord nach Süd…grenzenlos.
Claudia Lekondra
Ost und West, das ist doch nur eine Himmelsrichtung Teil III - Die Nacht, in der etwas Neues begann

Der für mich persönlich ergreifendste Moment dieser Tage des Jahres 1989 war jener, als ich das erste Mal in meinem Leben unter dem Brandenburger Tor stand. Es war der 22. Dezember 1989. An jenem Abend besuchte ich mit Freunden eine Kinovorstellung am Kurfürstendamm. Beim Verlassen des Kinos hörten wir, wie sich Passanten darüber unterhielten, dass der am Nachmittag geöffnete Grenzübergang am Brandenburger Tor für die West-Berliner an diesem Abend ohne Visum passierbar sei, was bedeutete, dass wir einfach spontan zum Brandenburger Tor fahren konnten.
Eine Vorstellung, die wir erst einmal kurz auf uns wirken lassen mussten. Wir waren alle nach dem Bau der Mauer geboren und es somit nicht gewohnt, spontan und schon gar nicht visumsfrei und ohne Mindestumtausch (von uns auch gern als Zwangsgeldumtausch oder Eintrittsgeld bezeichnet) in die DDR einzureisen. Bei der Einreise in die DDR oder nach Ost-Berlin, anlässlich eines Familienbesuches oder als Tourist, war man verpflichtet, einen bestimmten Betrag in DDR Mark zu einem vorgegebenen Kurs (1:1) zu tauschen. Die Höhe des umzutauschenden Betrages änderte sich über die Jahre mehrmals. Um ein Visum zur Einreise in die DDR oder nach Ost-Berlin zu erlangen, musste man als damaliger West-Berliner eines der fünf im West-Teil der Stadt ansässigen Büros der DDR für Reise- und Besuchsangelegenheiten aufsuchen. Dort wurde das Visum beantragt, das man sich dann nach einer Bearbeitungsdauer von zwei bis drei Tagen abholen durfte. Es war für einen Aufenthalt in Ost-Berlin oder dem Gebiet der DDR für 24 Stunden gültig. Wollte man mehrere Tage in der DDR oder Ost-Berlin verbringen, bedurfte es einer Einladung der Verwandten, die in der DDR lebten. Ausländer und die Bürger der restlichen Bundesrepublik Deutschland hingegen erhielten ihr Visum direkt bei der Einreise in die DDR. Ihnen war es daher möglich gewesen, jederzeit und somit spontan einzureisen.
An jenem Abend machten wir uns also mit dem Auto auf in Richtung Brandenburger Tor. Die Parksituation auf der Straße des 17. Juni war trotz der fortgeschrittenen späten Stunde chaotisch. Wir quetschten den Wagen in eine Lücke auf dem Mittelstreifen zwischen den anderen dort widerrechtlich geparkten Wagen. In dieser Nacht interessierte sich jedoch niemand für die Parksünder. Von dort lag noch ein Fußweg von zehn Minuten bis zum Brandenburger Tor vor uns. Wir glaubten nicht wirklich daran, dass wir so einfach ohne Visum in dieser Nacht auf die andere Seite der Mauer gelangen würden, dennoch war ich von einer positiven fast kindlichen Aufregung erfasst.
Immer wenn ich mir alte Fotoaufnahmen anschaute, auf denen man Leute sah, wie sie unter dem Brandenburger Tor hindurch flanierten, hatte ich mir vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn man eines Tages einfach wieder so durch das Brandenburger Tor spazieren könnte. In den Jahren der Teilung war das Tor unerreichbar. Es befand sich vom Westen aus gesehen auf der anderen Seite und somit trennte mich die Mauer vom Tor. Stand ich auf der damaligen Ost-Berliner Seite, verhinderte eine Absperrung, die sich einige Meter vor dem Tor befand, ein Hindurchgehen. Nur auserwählte Staatsbesucher der DDR durften sich dem Brandenburger Tor nähern. Ich wechselte tatsächlich in jener Nacht das erste Mal ohne Visum die Seiten der Stadt über den am Nachmittag neu eröffneten Grenzübergang in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor. Und dann stand ich direkt vor dem Tor und schaute es zum ersten Mal in meinem Leben aus unmittelbarer Nähe an. Es regnete und ich erinnere mich, dass ich den Regen nur am Rande wahrnahm, so beeindruckt war ich von diesem Moment. Ich stellte mich unter das Brandenburger Tor und berührte es. Es wies noch Einschusslöcher vom Krieg auf und machte einen mehr als restaurierungsbedürftigen Eindruck. Das Tor hatte offensichtlich unter Vernachlässigung gelitten, die der Trennung der Stadt und der dadurch bedingten Position des Tores geschuldet war. Und dann spazierte ich einfach unter dem Tor durch. Von einer Seite auf die andere und dann wieder zurück. Immer und immer wieder.
In dieser Nacht unter dem Brandenburger Tor ging nicht nur ein Kindheitstraum in Erfüllung, sondern in dieser Nacht spürte ich, dass etwas zu Ende ging und etwas Neues begann.
Claudia Lekondra
Ost und West, das ist doch nur eine Himmelsrichtung Teil II – Begegnungen und Ausnahmezustand

Laut den zurzeit in den Medien laufenden Dokumentationen zum Thema: 30 Jahre nach dem Mauerfall, wir ziehen Bilanz, ist die Rede davon, dass einige Menschen aus der ehemaligen DDR unzufrieden seien. Gründe der Unzufriedenheit sind neben der Lohnsituation unter anderem das Gefühl in einigen Gebieten der ehemaligen DDR abgehängt worden zu sein oder dass ihre bisherigen Lebensleistungen nicht anerkannt werden. Im Fokus stehen hier Menschen im Alter von 60plus, jene, die zum Zeitpunkt des Mauerfalls bereits einige Jahre im Berufsleben standen und es gewöhnt waren, in gesicherten geraden Bahnen ihr Leben zu leben. Niemand hatte sie darauf vorbereitet, dass die von ihnen so ersehnte Freiheit über die Selbstbestimmung hinaus auch etwas damit zu tun hat, die Fäden selbst in die Hand zu nehmen. Von der DDR waren sie anderes gewohnt. Eben klare Vorgaben. Die fielen nun weg. Sie fanden sich von einem Tag auf den anderen in einem System wieder, das ihnen fremd war, in dem sie erst einmal lernen mussten sich zurechtzufinden. Im Vorteil waren die Bürger der neuen Bundesländer, die Bekannte und Verwandte in den alten Bundesländern hatten, die ihnen idealerweise bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite standen. Die ihnen eben jene Orientierungshilfe leisten konnten, die eigentlich alle ehemaligen Bürger der DDR bedurft hätten. Aber in der Zeit der Euphorie jener Tage nach dem 9. November 1989 machten sich die meisten darüber keine Gedanken. Man lebte den Augenblick der Geschichte. Waren wir doch alle damals etwas überfordert von all diesen unglaublichen Eindrücken und Begegnungen.
Ende November des Jahres 1989 machte sich mein Vater, wie jedes Jahr zu dieser Zeit, auf den Weg zur Messe nach Hannover. Er plante, wie immer, in den frühen Morgenstunden von Berlin aus mit dem Auto nach Hannover aufzubrechen und am Abend zurückzukehren. Was er dabei nicht bedacht hatte war, dass gefühlt die Hälfte der damaligen DDR-Bürger auf den Straßen Richtung Westen unterwegs waren. Er fand sich in dem größten Stau wieder, den er je erlebt hatte. Die Autobahnen waren derartig überfüllt, dass ein Vorankommen nicht möglich war. Es ging stundenlang nichts mehr. Weder vor noch zurück. Es war kalt und ungemütlich, aber niemand regte sich auf, alle blieben entspannt. Man teilte Essen und Getränke und da es in den Trabis und Wartburgs bei den Außentemperaturen und dem mangelnden Sitzkomfort über Stunden doch eher ungemütlich wurde, boten die Besitzer der anderen Automodelle ihr Wageninneres zum Verweilen an. Man nutzte die gemeinsame Wartezeit für Unterhaltungen und fand sich damit ab, dass man kaum vorwärts kam.
Als die Nacht hereinbrach, gelang es meinem Vater mit ein paar anderen die Autobahn zu verlassen. In den anliegenden Dörfern öffneten die Bewohner ihre Türen und boten den Gestrandeten Asyl für die Nacht, und zwar für alle, egal, ob man aus dem Westen oder Osten kam. So übernachtete mein Vater in jener Nacht völlig unplanmäßig bei fremden Leuten, die ihm neben einer Schlafstelle auf der Couch auch mit Essen versorgten. Am nächsten Morgen frühstückte man entspannt gemeinsam, bevor man dann versuchte, seinen Weg fortzusetzen. Mein Vater berichtete davon, wie selbstverständlich sich dieser Zusammenhalt für alle Seiten anfühlte. Diese Möglichkeit des zwanglosen Austausches und der Unterstützung zwischen den Bürgern der DDR und denen aus der damaligen Bundesrepublik Deutschland wäre ein paar Wochen zuvor unmöglich gewesen. Achtete die DDR Regierung all die Jahre tunlichst darauf, dass Kontakte nur unter Verwandten der jeweils anderen Seite des Landes gepflegt werden durften.
Warum ich diese Geschichte erzähle? Weil wir diese Momente nicht vergessen dürfen. Diese und viele andere Begegnungen waren der Anfang eines Deutschlands, auf das wir doch seit dem Mauerbau immer gehofft hatten. Dass wir eines Tages einander wieder ungezwungen begegnen können und dürfen, wie und wo wir wollen und es dabei egal ist, aus welchem Bundesland wir stammen.
Claudia Lekondra
Ost und West, das ist doch nur eine Himmelsrichtung - Teil I Die Tage, als die Mauer durchlässig wurde

Vor 30 Jahren fiel die Mauer. Was waren das für Tage um den 9. November 1989 herum! Was für eine Stimmung, was für eine Euphorie! Ein jeder von uns erinnert sich daran, wo und wann ihn die Nachricht erreichte: Die Mauer ist gefallen! Nur ein paar Worte, die alles veränderten. Von jetzt auf gleich. Wobei die Aussage nicht korrekt ist. Am 9. November 1989 stand die Mauer natürlich noch, sie war jedoch in jener Nacht durchlässig geworden. Ich befand mich in Gatow bei einer Bekannten und bekam nichts davon mit, was gerade in meiner Stadt geschah. Erst am nächsten Morgen weckte mich meine Mutter mit dieser Nachricht. Von diesem Moment an war ich mitten im Geschehen. Schon am 10. November standen die ersten Familienmitglieder, die damals im Prenzlauer Berg lebten, bei uns vor der Tür. Was war das für ein schönes Gefühl. Sie kamen uns einfach besuchen. All die vielen Jahre waren die Familienbesuche einseitig und nun waren sie da und schauten, wie wir lebten. An diesem Abend sind wir spontan mit ihnen zum Kurfürstendamm gefahren und das Bild, was sich mir dort bot, werde ich nie vergessen. Aufgrund des Menschenandranges wurde der Kudamm an diesem Abend mehr oder weniger spontan zu einer Fußgängerzone erklärt. Die Polizei sperrte den Kudamm und zum Teil auch die angrenzenden Straßen für den Autoverkehr. Viele der Läden am Kudamm und Umgebung hielten sich an jenem Abend nicht an die gesetzlich vorgegebenen Öffnungszeiten, sondern ließen ihre Läden über die regulären Zeiten hinaus geöffnet. Und dies nicht in Erwartung eines großen Umsatzes, sondern weil sie den Menschen, die aus dem anderen Teil des Landes zu Besuch waren, ermöglichen wollten, den ganzen Abend durch die Läden zu bummeln. Zum einen fehlte es den Besuchern damals an den finanziellen Mitteln und zum anderen ging es an diesem Abend nicht darum etwas zu kaufen, sondern zu gucken. Sich alles anzuschauen in dieser Welt, die sie nur aus dem Fernsehen und bestenfalls aus Erzählungen kannten. Zu achtzig Prozent waren an diesem Abend Menschen aus der damaligen DDR unterwegs und was mir sehr nachhaltig in Erinnerung blieb, war die Ruhe, die trotz der Menschenmassen auf dem Kudamm herrschte. Viele sprachen nicht, sondern schauten nur. Und es gab viel zu schauen. Ich lief an diesem Abend ebenfalls schweigend über den Kudamm, überwältigt von diesem Moment, von dieser Stimmung. Ich erlebte, wie Ladenbesitzer Sachen verschenkten und ich empfand die Geste nie als gönnerhaft den Bürgern der damaligen DDR gegenüber, sondern als ein Ausdruck der Freude und eben auch der Euphorie seitens der damaligen West-Berliner. Ein Wunder war geschehen und man war live dabei. Auch noch Wochen und sogar Monate nach der Maueröffnung herrschte im damaligen West-Berlin ein Ausnahmezustand. Es wurden Straßenzüge im Zentrum von West-Berlin gesperrt, weil man seinen Trabant oder Wartburg aus Verzweiflung, da man keinen Parkplatz fand, einfach mitten auf der Straße abstellte. Parkplatzprobleme, etwas, was man in der ehemaligen DDR nicht kannte. Der öffentliche Nahverkehr West-Berlins brach fast zusammen, weil der Fahrplan der BVG nicht darauf ausgerichtet war, diese Masse von Besuchern zu transportieren und die Flotte nicht genügend Busse hergab. Es kam dann Hilfe aus dem Bundesgebiet und von Seiten der amerikanischen Militärbehörde. Man gewöhnte sich schnell daran, dass Militärbusse und Busse aus anderen Regionen des Landes im Auftrag der BVG unterwegs waren. Behelfsmäßig wurden Schilder an der Windschutzscheibe angebracht, die darauf hinwiesen, um welche Buslinie mit welcher Busendhaltestelle es sich handelte. Busfahrer fuhren extra Schichten, ebenfalls unterstützt von Kollegen aus anderen Regionen. In dieser Zeit beschwerte sich niemand über das Verkehrschaos, zu groß war die Freude darüber, dass die Mauer durchlässig geworden war. Ein jeder versuchte gelassen mit den erschwerten Bedingungen umzugehen. Denn bei all der Freude und dem Ausnahmezustand ging das Leben und damit der Alltag weiter. Irgendwie musste man zur Arbeit gelangen. In den Monaten nach dem Mauerfall verwandelte sich das Zuhause meiner Eltern zu einer Pension. Nach und nach besuchten uns die Familienmitglieder aus Quedlinburg, Chemnitz, Teltow, Buch und eben Prenzlauer Berg. Es war für meine Eltern sicher eine anstrengende, aber auch schöne Zeit. Über die Kosten sprach man damals nicht, war es doch für meine Eltern selbstverständlich, allen Kost und Logis zu gewähren und ihnen die Stadt zu zeigen. Unterwegs kehrte man mal zum Essen oder auf einen Kaffee und Kuchen irgendwo ein und natürlich übernahmen auch hier meine Eltern die Kosten. Wollten sie doch nicht, dass einer der Familienmitglieder sein kostbares Begrüßungsgeld dafür ausgeben musste. Theater, Kinos und auch einige der Konzertveranstalter gaben den Menschen aus der damaligen DDR Rabatte bis zu 50%, um ihnen einen Besuch zu ermöglichen. Und heute denke ich darüber nach, ob das eigentlich so richtig war. Erweckte man vielleicht durch die Großzügigkeit den Eindruck einer Leichtigkeit im Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln, die grenzenlos schienen? Aber damals, fragte keiner danach, man hatte einfach nur das Bedürfnis zu geben und schränkte sich mitunter in seinen persönlichen Ausgaben ein. Die Kino-, Theaterhäuser und Konzertveranstalter nahmen die finanziellen Einbußen vorübergehend hin. Darüber sprach man natürlich auch nicht. Ich erinnere mich an eine entfernte Bekannte, die in Kreuzberg lebte. Sie hatte ihr finanzielles Auskommen, aber einen Konzertbesuch konnte sie sich nicht leisten. Sie schaute schon etwas neidisch auf die, die einen DDR Pass besaßen, erklärte mir dann aber gleich, dass das ja eigentlich schon okay sei. Schließlich konnte sie all die Jahre auf der freien Seite der Stadt leben, während die anderen eingesperrt waren. Sie sah das als Wiedergutmachung für diese Jahre.
Gerade in den letzten Wochen denke ich oft über diese Aussage nach. Im Fernsehen werden jetzt viele Dokumentationen zum Thema gesendet: Wie schaut es aus in unserer Republik, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer? Auch in Talkshows bedient man sich verstärkt dem Thema. Erstaunt sitze ich dann dort und lausche den Gästen der Talkshows oder folge den Dokumentationen. Ständig geht es dort darum zu kritisieren, was seitens der Politik alles falsch gemacht wurde und es wird ständig von Ossi und Wessi geredet. Habe ich doch gedacht, dass wir Deutschen den diesjährigen Jahrestag zum Mauerfall feiern. Dass wir uns daran erinnern, dass für einige Bürger unseres Landes für Jahrzehnte die Freiheit nicht selbstverständlich war und seit nunmehr 30 Jahren alle Menschen in Deutschland in Freiheit leben. Ist das allein kein Grund zu feiern? Beim Zusammenwachsen unseres Landes sind sicher nicht alle Prozesse optimal gelaufen und mit dem Wissen von heute würde sicher vieles anders angepackt werden. Durch die Dokumentation und Talkshows ist mir klar geworden, dass wir zwar heute keine Mauer aus Beton und Stacheldraht mehr haben, dafür hat der eine oder andere aber seine Mauer noch im Kopf, die unser Land nach wie vor in Ost und West trennt und diese Mauer muss weg.
Claudia Lekondra
Eine Zugfahrt nach Nirgendwo

Im November 1938 wird der jüdische Kaufmann Otto Silbermann aus seiner Wohnung vertrieben. Mit einer Tasche voller Geld, das er vor den Nazis retten konnte, versucht er zunächst ins Ausland zu fliehen. Erfolglos. Seine Verwandten und Freunde sind verhaftet oder verschwunden und so reist er ziellos mit dem Zug durch Deutschland. Die Reichsbahn wird sein Zufluchtsort. Otto Silbermann begegnet während seiner Reise durch Deutschland unterschiedlichen Menschen der Gesellschaft jener Zeit. Denen, die aktiv Schuld auf sich laden, den Mitläufern, den anderen verängstigten Menschen und denen, die sich versuchen weg zu ducken. Dies ist die Geschichte des Romans „Der Reisende“ von Ulrich Alexander Boschwitz. Eine bedrückende Geschichte, die die Atmosphäre jener Tage in Deutschland wiederspiegelt. Die Art der Erzählweise gibt einem das Gefühl, als begleite man Otto Silbermann bei seiner ungewöhnlichen Reise. Man spürt die Angst, die Ausweglosigkeit und die Verzweiflung. Die Gespräche, denen man als Leser folgt, geben einem einen Eindruck der erschreckenden Realität jener Tage. Soweit hört es sich an wie einer der vielen Romane, die sich mit der Verfolgung der Juden im Nazi-Deutschland auseinandersetzen.
Was diesen Roman neben seinem Schreibstil, der kaum Distanz zulässt, außergewöhnlich macht, ist zum einen das Jahr der Entstehung des Romans sowie das Alter des Autors. Ulrich Alexander Boschwitz schrieb diesen Roman im Alter von 23 Jahren kurz nach den Novemberpogromen 1938 in nur wenigen Wochen in seinem Exil in Luxemburg und Brüssel. Das macht den Roman zu einem außergewöhnlichen Zeitdokument. Als Boschwitz diesen Roman schrieb, konnte er nicht wissen, was in den nächsten Jahren geschehen würde. Dass der Krieg ein Jahr später ausbrach, dass die Nazis die Juden nicht nur verfolgten, sondern ermordeten. Er erzählt in seinem Roman, dass die legale Einreise in europäische Länder, wie England, Frankreich oder der Schweiz 1938 geradezu unmöglich war. Auch Visa für die USA und die südamerikanischen Staaten waren kaum noch zu bekommen. Er schildert an dem Beispiel des Kaufmanns Silbermann, wie die Juden in der Falle saßen.
Der Roman wurde 1939 in England, 1940 in den USA und 1945 in Frankreich veröffentlicht. Ich habe darüber nachgedacht, wie die Geschichte wohl damals von den Lesern in diesen Ländern empfunden und verstanden wurde. Spürten sie auch diese Ausweglosigkeit und machten sich darüber Gedanken, warum unter anderem ihr Land den asylsuchenden Juden nicht zur Hilfe kam? Oder erkannten sie in diesen Tagen nicht die Realität, die dieser Roman schilderte? Boschwitz beschreibt in seinem Roman, wie die Weltgemeinschaft den Verbrechen, die sich in diesen Zeiten in Deutschland ereigneten, gleichgültig und passiv gegenüberstand.
Ebenso tragisch wie die Geschichte des Otto Silbermann liest sich das Schicksal des Autors. Boschwitz ist Halbjude und verlässt 1935 Deutschland. Er emigriert zunächst nach Schweden und lebt in den Jahren danach unter anderem in Oslo und Paris, bis er 1939 seiner Mutter nach England ins Exil folgt. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wird Boschwitz interniert und mit dem ehemaligen Truppentransporter Dunera in ein australisches Internierungslager gebracht. Die Überfahrt wird eine Tortur und geht in die britische Geschichte ein. Am 29.10.1942 stirbt Boschwitz bei dem Rücktransport auf dem Weg von Australien nach England. Ironie des Schicksals: Boschwitz befindet sich auf einem von der britischen Regierung gecharterten Passagierschiff, das von dem deutschen U-Boot U-575 torpediert wird. Das Passagierschiff sinkt und mit ihm 362 Passagiere. So erfuhr Borschwitz nie, was wirklich mit den Juden im Nazideutschland geschah. Er erlebte nicht das Ende des Krieges und somit auch nicht die Befreiung Deutschlands von den Nazis. Sein Roman, „Der Reisende“ machte ihn jedoch unsterblich. Zwar geriet der Roman in den darauffolgenden Jahren in Vergessenheit. Er wurde nach dem Krieg in Deutschland Verlagen angeboten, aber scheinbar bestand kein Interesse. Erst im Jahre 2015 wurde dieser Roman wiederentdeckt und mit Zustimmung der Familie des Autors lektoriert und 2018 erstmals in der Sprache veröffentlicht, in der er geschrieben wurde: In deutscher Sprache. Dieser Roman ist lehrreicher als jedes Geschichtsbuch.
Wie viele Romane wohl irgendwo da draußen darauf warten, entdeckt zu werden. Wie viele Geschichten darauf warten, erzählt und wie viele Menschen da draußen warten, gerettet zu werden.
Claudia Lekondra
Krieg, das ist immer irgendwo anders

Krieg, das ist immer irgendwo anders. Uns erreichen die Bilder der Kriege, die gerade stattfinden via Internet oder Fernsehen und uns erscheint alles so weit weg. Sie finden auf einen anderen Kontinent oder einer Region statt, mit der uns nichts verbindet. Die Bilder erschrecken und stimmen einen vielleicht für ein paar Minuten nachdenklich, doch dann gehen wir zum Tagesgeschehen über. Die Kriege, die in unserem Land stattgefunden haben, sind uns auch nicht näher. Sie sind Geschichte. Wir lesen Bücher darüber, sehen Dokumentationen und lauschen den Berichten der Zeitzeugen. Bei alledem empfinden wir eine distanzierte Betroffenheit, fühlt sich doch auch hierbei alles so weit weg an. Aber es gab einen Krieg, der in unserer Nähe stattfand, in einem Land, zu dem die meisten auch einen Bezug hatten und zu einer Zeit, die die Generation 40 + bewusst erlebt hat: Der jugoslawische Bürgerkrieg. Schon bei Ausbruch des Bürgerkrieges im Jahr 1991 stimmte es mich nachdenklich, dass sich nur wenige Menschen aus unserem Land mit diesem Krieg auseinandersetzten. Und dass, obwohl das damalige Jugoslawien ein beliebtes und von deutschen Urlaubern viel bereistes Land war. Die meisten von ihnen interessierten sich einfach nicht dafür, was der Auslöser dieses Krieges war. Und wie oft höre ich noch heute, dass man jugoslawisch Essen geht. Wenn ich dann darauf hinweise, dass es das nicht gibt, ernte ich entweder einen verwirrten Blick oder ein „Na Du weißt doch was ich meine“. Nein, weiß ich nicht. Nach all den Jahren ist es mir unverständlich, wie man mit so einem Desinteresse darauf reagiert und sich wundert, wenn man zum Beispiel in Dubrovnik selten Cevapcici oder Raznjici auf der Speisekarte findet. Längst bereist man wieder die Regionen des ehemaligen Kriegsgebietes. Kroatien mit seiner schönen Küste an der Adria, den Inseln und den malerischen Altstädten liegt hier ganz hoch im Kurs. Und natürlich soll man hier entspannt seinen Urlaub verbringen und sich nicht ständig vor Augen führen, was hier in den Neunzigern mitunter Schreckliches geschehen ist, aber kann und darf es uns so gleichgültig sein?
Während meines Urlaubes in Dubrovnik erkundete ich unter anderem die 1940 Meter lange Stadtmauer. Bei meinem Rundgang entdeckte ich einen Shop, der auf eine Filmdokumentation über die Belagerung der Stadt während des jugoslawischen Bürgerkrieges in den neunziger Jahren hinwies. Irritiert stellte ich fest, dass sich an diesem Tag außer mir scheinbar keiner der Touristen für diesen Filmvortrag interessierte. So saß ich dort allein und folgte den Filmaufnahmen von Privatpersonen und Journalisten, die die Belagerung der Stadt in den neunziger Jahren zeigten. Kein Kommentar begleitete die Filmaufnahmen, sondern nur die Geräusche der Granateinschläge, Schüsse sowie die Rufe und Schreie von Menschen. Ich erkannte die Straßen und Gassen Dubrovniks wieder, die ich in den letzten Tagen bereits mehrfach entlang flaniert war. Die Häuserfassaden wiesen Einschusslöcher auf, es fehlten teilweise Dächer oder Fenster. Es lag Geröll in den Gassen und hier und dort sah man einen Menschen von einer Deckung aus der Gasse zur nächsten eilen, ansonsten war niemand auf den Straßen unterwegs. Die Stadt wirkte wie ausgestorben. Die Aufnahmen zeigten Menschen, die in Räumen beieinandersaßen. Manchmal schweigend, manchmal unterhielten sie sich, zwischen ihnen spielten Kinder und im Hintergrund begleitete einen immer wieder das Geräusch der Granateinschläge. Ich sah Männer, die zu einer Seite des Onofrio Brunnen Deckung vor den Scharfschützen suchten, jener Brunnen, um den sich heutzutage so viele Touristen scharen, dass es tagsüber kaum möglich ist, sich den Brunnen anzuschauen. Man konnte sehen, wie auch außerhalb der Altstadt in Dubrovnik die Granaten einschlugen. Dort, wo sich auch mein Ferienappartement befand. Die ohne weitere Kommentierungen aneinander gereihten Filmaufnahmen von den Monaten der Belagerung kamen ohne Worte aus. Nichts lenkte einen von den Bildern ab, die sich dort vor einem abspielten. Man fühlte sich mittendrin und dies nicht nur wegen der Vertrautheit der Plätze, die dort der Schauplatz des Kriegsgeschehens waren. Auch aufgrund der Menschen und deren Kleidung war es schwierig, die Szenen distanziert zu betrachten. Es war nicht wie mit den Aufnahmen während des zweiten Weltkrieges, wo die Art, wie sich die Menschen kleideten und die Art, wie sie ihre Haare trugen, eben eine Distanz schaffte, weil das alles einer Zeit angehörte, lange bevor wir geboren wurden. Weil es bei diesen Aufnahmen aus dieser Zeit schwerfällt, Plätze einer Stadt wiederzuerkennen, da diese sich über die Jahrzehnte derartig verändert haben. Die Altstadt von Dubrovnik hat sich nicht verändert. Die Straßen und Gassen erkennt man auf den ersten Blick wieder.
Die Belagerung der Stadt durch die jugoslawische Volksarmee dauerte von Oktober 1991 bis Juni 1992. Sie forderte den Tod von 114 Zivilisten und 200 Soldaten auf kroatischer Seite. Zum Zeitpunkt der Belagerung befanden sich ca. 15.000 Flüchtlinge in der Stadt. Am 06.12.1991 fand der größte Angriff auf die Stadt statt. Die Armee versuchte, die Bewohner Dubrovniks zu einer Massenflucht zu bewegen. Die Zufuhr von Wasser und Strom war zuvor unterbrochen worden. An diesem Tag gingen 600 Granaten auf die Stadt nieder. So gut wie fast alle historischen Gebäude wurden beschädigt. Dubrovnik und Umgebung war seit den siebziger Jahren ein demilitarisiertes Gebiet. Die Angriffe galten ausschließlich zivilen Objekten und Zielen. Daher wird der Angriff auf Dubrovnik und Umgebung als Kriegsverbrechen gewertet.
Während all die anderen Touristen ihren Rundgang auf der Stadtmauer fortsetzten, ohne sich diese Dokumentation anzuschauen, dachte ich darüber nach, warum ich dort allein saß. Ich war doch nicht die Einzige, die in den achtziger Jahren im damaligen Jugoslawien ihren Urlaub verbrachte. Die dort die Menschen kennengelernt hatte. Ich war doch nicht die Einzige, die bereits Mitte der achtziger Jahre bemerkte, dass das Land gespalten war.
Später saß ich bei einem Glas Wein auf der Terrasse meines Ferienappartements und genoss den malerischen Blick auf die Altstadt. Im Hintergrund glitzerte das scheinbar endlose Meer und am fernen Horizont beobachtete ich ein Kreuzfahrtschiff, das seine Bahnen zog. Im Küstenbereich tummelten sich Segel- und kleinere Ausflugsboote. Die Vögel zwitscherten, in der Ferne hörte man Autos hupen. Während ich dort saß und über den Film nachdachte, schien alles so unwirklich. Die Stadt ist längst wiederaufgebaut und auf den ersten Blick erinnert nichts mehr an den Krieg. Ich hatte zunächst fast ein schlechtes Gewissen, dass ich trotz der Bilder der Belagerung in meinem Kopf und in meinen Gedanken den Ausblick genoss und mich gut fühlte, bis mir klar wurde, dass eben wegen dieser Bilder und Gedanken ich in diesem Moment ein Gefühl von Frieden und Freiheit verspürte.
Claudia Lekondra
Die Liebe ist ein Gewürz

Welchem Genre sind denn Deine Bücher zuzuordnen? Diese Frage wird mir immer wieder gestellt. Das sind die Momente, in denen ich meine schreibenden Kollegen beneide, die zu dieser Frage eine aussagekräftige Antwort liefern, weil sie sich den Thrillern, Krimis, Liebesromanen, romantischen Komödien, Abenteuerromanen, Fantasy-Romanen, Science-Fiction-Romanen, Dramen oder der Lyrik verschrieben haben. Sie haben auch keine Schwierigkeiten, ihre Bücher auf den verschiedenen Verkaufsplattformen einem Genre zuzuordnen und erreichen so schnell und unkompliziert die passenden Leser für ihre Geschichten.
Bei der Positionierung meiner Bücher auf diesen Verkaufsplattformen sitze ich dann stets etwas ratlos da. Die meisten Vorgaben passen eben nicht. Letztens wies mich jemand darauf hin, dass sich meine Romane mit unterschiedlichen Themen beschäftigen, aber immer geht es nebenbei auch um die Liebe. In all meinen Geschichten kommt sie vor und spielt mehr oder weniger, mal offensichtlich, mal weniger offensichtlicher, eine Rolle. Die Liebe, die uns in den unterschiedlichsten Formen in Beziehungen begegnet, wo wir sie mitunter nicht vermuten. Die Liebe, die so viele Facetten bedient und daher oder besser ausgedrückt, deshalb manchmal nicht immer gleich zu erkennen ist. Die Liebe, die sich gelegentlich durch die Hintertür schleicht, die wir manchmal einfach davonjagen möchten, weil wir glauben, dass sie keinen Platz in unserem Leben hat, weil wir sie in dieser Lebensphase gerade nicht gebrauchen können. Die Liebe, die sich nicht mit dem Kopf steuern lässt, denn Liebe ist nicht logisch. Warum liebt man diesen Menschen und nicht den anderen? Warum fühlt man sich von manchen Menschen angezogen, von deren Lächeln, Lachen, Gestik, Geruch, während andere Menschen uns weder mit ihrem Lächeln, Lachen, deren Gestik oder Geruch emotional erreichen? Mitunter macht die Liebe unfrei, bleibt unerfüllt. Manchmal wächst sie über Jahre und erhält sich über Jahre. Liebe ist nicht in Kategorien einzuordnen, in groß oder klein, in stark oder schwach. Diese Gefühle im Zusammenhang mit der Liebe haben innerhalb von Momentaufnahmen eine unterschiedliche Intensität, die nichts mit einem Größenverhältnis zu tun hat. Seine Mutter liebt man anders als den Vater. Jedes seiner Kinder liebt man auf eine andere Art. Seine Geschwister, Cousins und Cousinen, Tanten und Onkel liebt man unterschiedlich (und manchmal auch nicht). In einer Liebesbeziehung liebt man den jeweiligen Partner nicht wie den anderen. Neben der Eltern-, Geschwister- und Partnerliebe ist da noch die freundschaftliche und platonische Liebe, der wir in unserem Leben begegnen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es vierzehn Arten der Liebe gibt. Kein Wunder, dass bei so viel verschiedenen Arten der Liebe sie in ihren unterschiedlichen Facetten in meinen Romanen auftaucht. Die Liebe ist zu komplex, um eine einzige Definition für sie zu finden, also ein guter Grund, warum es so viel über die Liebe zu erzählen gibt und sie immer wieder in meinen Romanen ihren Platz finden wird. Die Liebe ist schließlich das Gewürz in unserem Leben. Und nun werde ich einfach mal auf den jeweiligen Plattformen das Schlagwort Liebe mit eingeben und wenn mich nächstens jemand fragt, welchem Genre meine Romane zuzuordnen sind, versuche ich es einfach mal mit der Antwort: „Liebesromane Plus“.
Claudia Lekondra
Die Sache mit der Gelassenheit

Im Alltag sind wir stets bemüht, unsere Zeit effektiv zu nutzen. Wir reagieren gestresst und genervt bei dem Gefühl, unsere kostbare Zeit zu vergeuden. Wenn wir einen Arzttermin haben, pünktlich in der Praxis erscheinen und dann noch eine halbe Stunde im Wartezimmer verbringen, der Flieger Verspätung hat und wir ungeplant eine Stunde auf dem Flughafen ausharren, der Bus oder die U-Bahn sich verspäten und wir auf der Straße oder auf dem Bahnhof stehen und warten. Oder wenn wir mit dem Auto in einen Stau geraten und sich seit einer Viertelstunde gar nichts mehr im Straßenverkehr bewegt. Dieses Warten empfinden wir als Zeitverschwendung. Ich habe mir angewöhnt, mich in solchen Situationen in Gelassenheit zu üben. Nicht immer einfach, aber es gelingt immer öfter. Zunächst versuche ich die Situation nicht zu bewerten, sondern sie hinzunehmen. Wenn ich in diesem Moment nichts ändern kann, wäre es müßig seine Energie damit zu verschwenden. Dann versuche ich meinen Gedankenfluss (was jetzt alles nicht mehr in meinen Zeitplan passt, da die Wartezeit es mir unmöglich macht, ihn einzuhalten) zu unterbrechen, denn er verursacht nur Stress. Stattdessen versuche ich mich darauf zu besinnen, dass eben auch diese Wartezeit einen Teil meiner Lebenszeit ausmacht und ich sie sinnvoll nutzen sollte, indem ich mir zum Beispiel die Umgebung anschaue oder einen Artikel auf meinem Smartphone lese, den ich schon seit zwei Tagen lesen wollte. Oder ich nutze die Zeit, eine E-Mail zu beantworten und vielleicht noch spontan ein privates Telefonat zu führen. Entspannen, einfach nur Musik hören, die Gedanken vor sich hin tanzen lassen und dabei versuchen, sich auf die dieser Situation geschuldeten Möglichkeit der Entschleunigung einzulassen. Ich habe letztens eine schöne philosophische Ausführung zum Thema Zeit gelesen: Zeit beschreibt das Fortschreiten der Gegenwart von der Vergangenheit kommend zur Zukunft. Also: in halbwegs naher Zukunft wird man das Wartezimmer verlassen und zum Arzt vorgelassen, den Flieger besteigen und sein Ziel erreichen. Auch der Bus oder die U-Bahn werden eintreffen und der Stau wird in Zukunft zur Vergangenheit gehören. In diesem Sinn: Om!
Claudia Lekondra
Irgendwann wird die Zukunft zum Heute

Früher war alles besser... Beim Zusammentreffen mit der Generation 70plus lässt es sich oftmals nicht vermeiden, mit dieser Aussage konfrontiert zu werden. (Bevor es jetzt zu Empörungsrufen einiger von der Altersangabe her betroffenen Lesern kommt, sei an dieser Stelle der Hinweis erlaubt: Ausnahmen bestätigen natürlich wie immer die Regel). Früher war alles billiger, die Menschen waren höflicher, es gab weniger Arbeitslose, weniger Kriminalität, die Menschen waren nicht so rücksichtslos, der Straßenverkehr war weder so gefährlich noch so aggressiv, es gab weniger Scheidungen, die Kindheit war sorgloser und so weiter und sofort. Nicht, dass ich kein Verständnis dafür habe, dass es nicht immer einfach ist, mit zunehmendem Alter, sich in unserer schnelllebigen technisierten Welt zurechtzufinden. Das der heutige Straßenverkehr auf einen Menschen mit Ende 70 aggressiver wirkt, als noch vor 30 Jahren, ist allein dem Umstand geschuldet, dass man nun mal mit 70 weder die Nerven noch den Überblick eines 40jährigen hat. Und natürlich verbindet jede Generation mit ihrer Jugend ein bestimmtes Lebensgefühl. Die positiven Erinnerungen bleiben im Gedächtnis, während die Negativen verblassen. Zurück bleibt die nostalgische Stimmung, die den Blick auf das Früher verklärt. Wenn man dann, die Aussage früher war alles besser mit Statistiken, beispielsweise zum Thema Arbeitslosigkeit, Armut, Verkehrstote und Kriminalität zu entkräften versucht und man in diesem Zusammenhang darauf hinweist, dass sich in den letzten 25 Jahren die Lebensqualität verbesserte und die Lebenserwartung erhöht hat, scheint eine Statistik als Argument bei der Generation 70plus nicht zu gelten. Wenn man vorsichtig nachfragt, ob sie wirklich der Meinung sind, dass Ihre Kindheit während des Krieges und im Nachkriegsdeutschland sorgloser gewesen sein soll, als die Kindheit des heutigen Nachwuchses, wird allen Ernstes behauptet, dass man eine sorglose Kindheit hatte. Es wird von den schönen Sommern berichtet, wie man in der Stadt barfuß auf den Straßen spielte, da so gut wie kein Verkehr herrschte und man sich frei bewegen konnte, weil man nicht hinter jeder Ecke Gefahren vermutete. Die Bombennächte im Luftschutzkeller, Hunger, Kälte, Flucht und Vertreibung scheinen tatsächlich völlig in der Nostalgie zu verblassen. Heutzutage können die Kinder tatsächlich aufgrund des Verkehrsaufkommens nicht auf den Straßen der Städte spielen und sie sind auch nicht barfuß in der Stadt unterwegs. Aber die meisten Kinder in unserem Land haben die Möglichkeit, barfuß an den einen oder anderen Stränden dieser Welt spazieren zu gehen und ihre Kindheit in all ihrer Sorglosigkeit und Unbeschwertheit zu genießen. Bezüglich der Scheidungen kann ich tatsächlich nicht mit Statistiken gegenhalten. Es gab tatsächlich früher weniger Scheidungen als heutzutage. Oftmals kam es nicht zu einer Scheidung, da seinerzeit eine Scheidung in der Gesellschaft als Makel angesehen wurde. Hinzukam, dass damals die Frauen beruflich nicht so gut gestellt waren und somit nicht in der Lage gewesen wären, bei einer Scheidung ihren eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren (und mit zwei oder drei Kindern sowieso in der Berufswelt damals nichts verloren hatten). Die Ehefrauen waren mitunter bis in die siebziger Jahre auf ihren Ehemann als Versorger angewiesen. Als scheidungswilliger Ehemann nahm man von der Idee der Scheidung Abstand, weil man sich die Unterhaltszahlung an seine geschiedene Ehefrau nicht leisten wollte oder konnte (hierzu der Hinweis, dass damals bei einer Scheidung das Schuldprinzip Anwendung fand). Und diese Situation war früher besser als heutzutage, wo man sich scheiden lässt, wenn es nicht mehr geht, anstatt sich die nächsten 30 Jahre noch aushalten zu müssen? Wirklich? Ich habe es zwischenzeitlich aufgegeben, mich zu all diesen Behauptungen zu äußern. Aber immer wieder folge ich erstaunt dieser altersbedingten verzerrten Wahrnehmung zum Früher und Heute. In solchen Momenten denke ich darüber nach, ob ich in 30 Jahren auch dasitzen und erklären werde, früher war alles besser. Okay, ist auch nicht so schlimm. Denn wenn ich in der Zukunft behaupten werde, dass früher alles besser war, spreche ich ja eigentlich von Heute. Also genieße ich die Gegenwart und freue mich auf die Zukunft, denn die wird schließlich auch irgendwann zum Heute.
Claudia Lekondra
Die Begegnung mit einem Glückskeks

Glückskekse sind sicher jedem bekannt. Man erhält dieses kleine süße Gebäck in unseren Breitengraden in einigen chinesischen Restaurants nach dem Essen gereicht. Sie beinhalten einen kleinen Papierstreifen, auf dem sich ein Sinnspruch oder eine Zukunftsbedeutung befindet. Ursprünglich kommen diese Kekse aus Japan. In China tauchte dieses Gebäck erstmals um 1990 auf. Dieser Hinweis nur mal so am Rande, das ist eigentlich eine andere Geschichte. Zurück zum Glückskeks. Kulinarisch bin ich der chinesischen Küche nicht sonderlich zugewandt, so dass ich kaum die Gelegenheit habe, einen Glückskeks zu knacken. Im Januar landete dann ein solcher Keks bei mir Zuhause. Ein Mitbringsel von Freunden, die zu Besuch kamen und diesen mir nachträglich zum Jahreswechsel überreichten. Der Spruch, der zum Vorschein kam, lautete: „Sie beweisen ihr diplomatisches Geschick“. Da ich sonst nie auf diese Kekse treffe und mir dieser nachträglich zum Jahreswechsel überreicht wurde, werte ich diesen Satz mal als Zukunftsbedeutung für das Jahr 2019. Auf mich und meine Ziele bezogen klingt das erst einmal nicht schlecht, denn der Satz besagt ja, dass ich diplomatisch erfolgreich sein werde, und nicht, dass ich mein diplomatisches Geschick unter Beweis stellen muss. Diplomatie bedeutet ja, Ziele durchzusetzen, ohne sich unbeliebt zu machen. Unbeirrbar sein Ziel verfolgen, flexibel und kreativ. So dachte ich im ersten Moment und wollte diesen Glückskeksen schon ihre Daseinsberechtigung anerkennen. Aber dann kam mir der Gedanke: Was, wenn es nicht um mich und meine Ziele geht, sondern um mein Umfeld? Was, wenn ich in zwischenmenschliche Probleme meines Umfeldes hereingezogen werde und diese mit Diplomatie entschärfen soll? Wenn ich die nächsten Monate umgeben bin von festgefahrenen Konflikten und ich meine ganze Energie für mein diplomatisches Geschick aufbringen muss. Das kann ja heiter werden, ging es mir durch den Kopf. Aber wie so oft im Leben, ist ja alles eine Auslegungssache. Also belasse ich es bei meiner ersten Auslegung und werte diesen Spruch positiv und freue mich einfach mal darauf, dass ich in diesem Jahr mit meinem diplomatischen Geschick auf Siegeszug gehen werde. Dann suche ich mir jetzt einfach mal das erste passende Projekt dazu.
Claudia Lekondra
Was wird von 2018 bleiben?

Da ist es, das Jahr 2019! Vielleicht blickt der eine leicht melancholisch dem Jahr 2018 hinterher, und ein anderer ist froh, dass dieses von ihm persönlich als weniger gut empfundene vergangene Jahr endlich Geschichte ist. Noch ist uns 2018 in seinen Details gegenwärtig, aber mit den Jahren werden die Details verblassen. Denken wir zum Beispiel heute an das Jahr 2001, fällt uns allen hierzu sofort 09/11 ein. Jeder von uns erinnert sich, wo er sich gerade aufhielt, als Terroristen zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers lenkten. Wir erinnern uns, wann und wie uns die Nachricht erreichte, aber erinnern wir uns auch genau, was sonst in diesem Jahr los war? Was wird in siebzehn Jahren von 2018 in unserer Erinnerung bleiben? Werden wir uns an den Jahrhundertsommer erinnern oder bleiben uns eher die persönlichen Erlebnisse in Erinnerung und der Sommer wird verblassen? Vielleicht, hätte, würde, könnte…2018 ist Vergangenheit. 2019 liegt vor uns. Zwölf Monate, die darauf warten, gefüllt zu werden mit schönen Stunden zusammen mit Familie, Freunden und Bekannten. Begegnungen mit Menschen, die uns unerwartet passieren. Momente, die uns erstaunen, Entscheidungen, die uns zweifeln lassen. Rückschläge, die wir hinnehmen müssen, Enttäuschungen, die einem manchmal nicht erspart bleiben. Vielleicht bemerken wir neue Leidenschaften, verabschieden uns von Gewohnheiten und erfreuen uns an Dingen, die wir für uns neu entdecken. Lasst uns keine Zeit vergeuden. Noch fühlt sich das neue Jahr nach Zukunft an. Machen wir es zu unserer Gegenwart. In diesem Sinne: Happy New Year!
Claudia Lekondra
Auf der Suche nach dem Warum habe ich ein Egal gefunden

Mit Anfang zwanzig hatte ich noch eine ideale Vorstellung von meiner Lebensführung. Ich schien mir ganz sicher in meiner moralischen Sichtweise, glaubte zu wissen, was richtig und was falsch war. Fühlte ich mich ständig dazu berufen, die Schwächeren zu unterstützen, indem ich diesen Menschen eine Stimme gab. Ich glaubte mich für alles und jeden stark machen zu müssen und die von mir empfundenen Ungerechtigkeiten ertrug ich nur schwer. Das gute am Älterwerden ist, dass man aufgrund der gesammelten Lebenserfahrung gelassener mit allem umgeht. Es regt mich nicht mehr wirklich viel auf und ich habe gelernt, mit einem gesunden Egoismus den Widrigkeiten des Alltages zu trotzen. Als ich begriff, dass der Idealismus mich meinen Zielen nicht wirklich näherbrachte, habe ich erkannt, dass Egoismus hierbei um einiges hilfreicher ist. Egoismus, dieses völlig zu Unrecht negativ behaftete Wort. Es liegt in der Natur des Menschen, egoistisch und nicht selbstlos veranlagt zu sein. Also kümmerte ich mich erst um meine eigenen Ziele, indem ich mich auf mich und meine Vorstellungen und Wünsche konzentrierte, ohne zum einen ständig auf die Befindlichkeiten anderer Rücksicht zu nehmen und zum anderen, mich nicht davon ablenken zu lassen, mich für andere stark machen zu müssen. Erst an sich zu denken bedeutetet ja nicht unweigerlich, dass einem die anderen egal sind. Es geht nicht um ein entweder ich oder die anderen, sondern um sowohl als auch. Und mal ehrlich: Hilfsbereitschaft löst doch ein gutes Gefühl in einem aus, oder? Wenn wir anderen helfen, fühlen wir uns besser. Unser scheinbar selbstloses Verhalten hat also einen egoistischen Hintergrund. Klingt nicht gut, ist aber nun mal so. Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass sich meine moralische Sichtweise verschoben hat und ich zwischenzeitlich weit davon entfernt bin, beurteilen zu wollen, was richtig oder falsch ist. Ich suche nicht mehr nach dem Warum, sondern sorge immer erst einmal dafür, dass es mir gut geht. Und wenn es mir gut geht, kann ich etwas dazu beitragen, dass es den Menschen in meinem Umfeld gut geht und wenn es meinem Umfeld gut geht und noch Zeit bleibt, dann sehen wir weiter.
Claudia Lekondra
Bücher sind das Tor in eine andere Welt

Bücher begleiten mich bereits mein ganzes Leben. Sie haben wie selbstverständlich einen beständigen Platz in meinem Leben eingenommen. Ein Leben ohne Bücher- es klingt vielleicht jetzt etwas pathetisch- kann ich mir nicht vorstellen. Lange bevor ich selbst in der Lage war, die aneinander gereihten Buchstaben zu erfassen und zu verstehen, war ich bereits der Welt der Bücher verfallen. Damals wurde mir vorgelesen und ich erinnere mich, wie ich die Schulzeit herbeisehnte, einzig aus dem Grund, dann in der Lage zu sein, meinen Lesedurst allein zu stillen und mich nicht mehr in der Abhängigkeit gegenüber dem Vorleser zu sehen, wann, wo und wie lange gelesen wurde. Was war ich nach den ersten Wochen meiner Schulzeit enttäuscht, als ich realisierte, dass es etwas Zeit bedurfte, bis man des Lesens mächtig war. Wie ungeduldig ich immer und immer wieder versuchte, zu lesen. Abtauchen in eine andere Welt, in ferne Länder und Kulturen. In der Welt der Bücher auf Menschen treffen, deren Gedanken und Gefühle nachzuempfinden, die Handlungen und Wandlungen der Protagonisten zu verstehen. Sich an Themen heranwagen und dabei die eigene Weltanschauung zu überdenken. Bücher machen etwas mit einem. Sie verändern einen, wenn man es zulässt. „Sofies Welt“ von Jostein Gaarder führte mich das erste Mal in die Welt der Philosophie. Es beeinflusste nachhaltig meine Sichtweise. Der Satz von Sokrates: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“, bekam für mich eine neue Bedeutung. „Die Wand“ von Marlen Haushofer hinterließ ebenfalls Spuren und brachte mir das Thema Selbstreflexion nahe. Ich empfand es aufwühlend und beängstigend, da die Autorin es mit ihrer ruhigen unaufregenden Erzählweise schafft, dass man die Einsamkeit und Isolation der einzigen Protagonistin fühlt und ich war erstaunt, wie mich eine Geschichte fesselte, in der nicht wirklich viel passiert, sondern die Spannung einzig und allein von den Gedanken der Protagonistin getragen wird. Auch der Roman von Edgar Hilsenrath „Der Nazi und der Friseur“ machte etwas mit mir. War ich doch der Meinung gewesen, dass die Geschichten über die Judenverfolgung alle erzählt sind, die Romane sich in ihrem Drama gleichen. Hilsenrath schafft es mit einer aberwitzigen grotesken sarkastischen Erzählweise und mit bizarren Einfällen eine wirklich neue schockierende Geschichte zu diesem Thema zu liefern, bei der man erschaudert und der Wahnsinn einem in einem neuen Blickwinkel erscheint. Nachhilfeunterricht in Sachen Geschichte, betreffend Israels Staatsgründung und die Situation beider Seiten während des Unabhängigkeitskampfes lieferte mir der Roman von Werner Sonne „Wenn ich dich vergesse, Jerusalem“. Sprachlich beeindruckten mich unter anderem nachhaltig zwei Klassiker: Thomas Manns „Zauberberg“ und Jane Austens „Stolz und Vorurteil“. Einfach ein Genuss; diese Romane leben von der Kraft der Erzählweise und vermitteln ein Gefühl längst vergangener Zeiten. Nachvollziehbarer und verständlicher als jedes Geschichtsbuch, transportieren sie den Zeitgeist jener Zeit ihrer Entstehung in unsere Gegenwart.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die zurzeit in meinem Regal stehenden Bücher zu zählen und kam auf 330 Bücher (Sachbücher nicht mitgezählt) und ich habe sie tatsächlich alle gelesen! Da stellt man sich die Frage, wie viele Bücher man in seinem Leben bereits gelesen hat und wie viele Bücher wird man noch lesen? Aber eigentlich ist es doch egal. Was zählt sind die Geschichten, die hängen bleiben, die etwas in uns bewegen und die Geschichten, die darauf warten, noch gelesen zu werden. Die Erfindung des Buchdruckes ist eines, wenn nicht das größte Ereignis der Weltgeschichte. Ohne Bücher keine Bildung und ohne Bildung keine Orientierung, ohne Orientierung keine Identität und ohne Identität keine Persönlichkeit.
Claudia Lekondra
Das Wort Freundschaft, so oft ausgesprochen, so selten gehalten

Es gibt Bücher, die hinterlassen Spuren, die machen etwas mit einem. Bei mir hinterließ der Roman „Die Glut“ von Sándor Márai (1900-1989) vor gut zwanzig Jahre seine Spuren. Mich beeindruckte die unglaubliche Intensität der Erzählung. Als eine Art Kammerspiel erzählt Sándor Márai in Form eines Monologes von zwei ungleichen Freunden, dem reichen General Henrik und dem aus verarmtem polnischem Adel stammenden Konrad. Nach über vier Jahrzehnten treffen die beiden an einem Abend in Henriks altem Schloss wieder zusammen. Konrad verschwand seinerzeit über Nacht aus Henriks Leben und Henrik erhofft sich, an jenem Abend nun endlich zu erfahren warum. Der Abend und die Nacht werden immer mehr zu einem inneren Monolog Henriks, indem er sich unter anderem mit den Begriffen Freundschaft, Treue, Ehre und Demut auseinandersetzt. „Das Wort Freundschaft, so oft ausgesprochen, so selten gehalten. Oder interpretieren wir etwas Falsches hinein?“ Ich war damals von der Art und Weise, wie sich Sándor Márai mit dem Begriff und der Bedeutung der Freundschaft in dieser Geschichte auseinandersetzt berührt und erkannte, dass ich es genauso sah. Obwohl ich seinerzeit sehr beeindruckt von diesem Buch war und ich mir fest vornahm, es noch einmal zu lesen, sind nunmehr fast zwanzig Jahre verstrichen. Ich war etwas zögerlich, weil ich befürchtete, dass ich mir den Eindruck, den das Buch seinerzeit hinterlassen hatte, im Nachhinein verderben würde, dass es eben die Spuren wieder verwischt. Aber dem war so nicht. Die Erzählweise, Hendriks Überlegungen und die wunderschöne klare Sprache haben mich gleich wieder in den Bann gezogen.
„Kameradschaft und Kumpanei sehen bisweilen nach Freundschaft aus. Gemeinsame Interessen können zwischenmenschliche Interessen schaffen, die der Freundschaft gleichen...“
Was für eine schöne Beschreibung! Wenn man eine engere Bekanntschaft oder Kameradschaft ganz klar von einer Freundschaft zu unterscheiden lernt, bleiben einem Enttäuschungen erspart. Engere Bekanntschaften und Kameradschaften gehören zu unserem Leben und bereichern es ebenso wie Freundschaften. Ohne diese zwischenmenschlichen Beziehungen wäre unser Leben leer. Man entwickelt eher eine engere Bekanntschaft und Kameradschaft, als eine echte Freundschaft. Auf dem ersten Blick gleichen sich die Beziehungen. Man begegnet sich, findet sich sympathisch und man stellt fest, dass man – jedenfalls oberflächig betrachtet - ähnliche Wertvorstellungen hat. Gemeinsame Interessen, wie ein Hobby oder die Arbeit, schaffen eine Verbindung, woraus sich eine engere Bekanntschaft entwickeln lässt. Eine wahre Freundschaft ist hiervon frei. Eine Freundschaft wächst ganz langsam. Die Werte, die man teilt, liegen meist nicht an der gesellschaftlichen Oberfläche, sondern gehen tiefer. Alter und Herkunft sind bei einer wahren Freundschaft nicht ausschlaggebend. Uneingeschränktes Vertrauen, Loyalität und gegenseitige Wertschätzung, die frei von jeglicher materiellen Art ist, sind die Grundsteine einer wahren Freundschaft. Mitunter ist Freundschaft von einer Art Seelenverwandtschaft geprägt. Ein wahrer Freund versteht, warum man ist, wie man ist, warum man so handelt, wie man handelt, wobei er nicht mit alledem übereinstimmen muss. Wahre Freundschaft übersteht unterschiedliche Entwicklungen. Sie übersteht es, wenn sich die Lebensmodelle in verschiedene Richtungen verändern, weil da immer noch so viel bleibt, was einen verbindet. Eine Freundschaft ist mehr von Achtung, als von Bewunderung geprägt, einem Freund vertraut man seinen Schmerz an, sein Glück teilt man mit jedem. Diese Überlegungen waren mir alle wieder gegenwärtig, während ich Sándor Márais „Die Glut“ ein zweites Mal las. Einige engere Bekannte von damals gehören immer noch zu meinem Leben, andere sind gegangen und wieder andere sind dazu gekommen und ein Freund, der bleibt sowieso.
Claudia Lekondra
Ein schöner Rücken kann auch entzücken

Ein schöner Rücken kann auch entzücken dachte ich mir, als ich durch Zufall dieses schöne Kleid in einer Boutique entdeckte, während ich eigentlich in einem anderen Auftrag unterwegs war. Da ich nicht zu dem Kreis der Shopping Queens (Kings) & Co gehöre und meine Garderobe sich überwiegend durch Zufallsbegegnungen zusammenstellt, griff ich die Gelegenheit beim Schopfe und schlüpfte spontan in das Objekt meiner Begierde. Und dann war es eben dieser tolle Rückenausschnitt, der mich dazu bewog, dieses Kleid unbedingt haben zu wollen. Es passte wie angegossen. Ich war mir sicher, dass ich mit diesem Kleid in meiner Tasche die Boutique wieder verlassen würde. Aber dann stand ich doch etwas ratlos vor dem Spiegel. Der Rückenausschnitt war -wie bereits erwähnt – tief, so dass der Verschluss meines BHs ungewollt in den Blickmittelpunkt gestellt wurde.
Sah nun nicht so wirklich gut aus und war sicher nicht im Sinne des Designers. Also probierte ich das Kleid ohne BH an. Ging auch nicht. Es zeichnete sich alles ab. Näher möchte ich an dieser Stelle nicht darauf eingehen. Zu diesem Zeitpunkt war ich jedoch längst auf verlorenem Posten. War ich doch wild entschlossen, dieses Kleid zu kaufen. Für das Problem mit dem Verschluss gab es doch sicher eine Lösung. Schließlich war ich ja nicht die erste weibliche Person, die ein tief ausgeschnittenes rückenfreies Kleid tragen und hierbei nicht auf einen BH verzichten wollte. Was ich benötigte, war ein Tipp von erprobten Rückenfreitragenden. Also befragte ich als erstes die junge Dame an der Kasse der Boutique, wie sie denn in ähnlichen Fällen das Problem löste. Zu meiner Verwunderung war sie ebenso ratlos. Nie zuvor hatte sie vor einem solchen Problem gestanden und auch der Umstand, dass sie in einer Damenboutique arbeitete, schien sie noch nie dazu veranlasst zu haben, sich Gedanken darüber zu machen, um gegebenenfalls eine Kundin entsprechend beraten zu können. Immerhin zögerte sie keinen weiteren Moment und rief ihre Kollegin, die in den Tiefen des Lagers verschwunden war, zu Hilfe. Wenn es sich um einen schönen Verschluss handle, könne man das Kleid doch durchaus so tragen. Der BH hätte eben auf der tiefausgeschnittenen Rückenfront seinen Auftritt, schlug sie mir vor. Als sie meinen skeptischen Blick bemerkte, kam ihr die Idee, es mit einem selbstklebenden BH zu versuchen, aber damit habe sie keine Erfahrung. Ich solle mich hierzu mal in einem Dessous-Laden beraten lassen. Das klang doch nach einem Plan.
Mit dem tollen Kleid in der Tasche zog ich los und erklärte meiner männlichen Begleitung, ich müsse mal kurz in dem nächsten Dessous-Laden einen Zwischenstopp einlegen. Gesagt getan. Es gibt schließlich Schlimmeres für die Herrenwelt, als einen Dessous-Laden zu betreten. Doch man kam erst gar nicht dazu, sich intensiver umzuschauen. Man konnte mir dort nicht helfen. Man führte keine selbstklebenden BHs. Die freundliche Verkäuferin gab mir jedoch den Tipp, es zwei Läden weiter, in dem Laden XY, zu versuchen. Zwar noch motiviert, da das neu erworbene Kleid in der Tasche anspornte, aber doch schon leicht genervt und unter Zeitdruck, trug ich mein Anliegen zwei Ladentüren weiter vor. Und damit nahm alles seinen Lauf.
Ich, beziehungsweise wir, wurden in der nächsten Stunde in die Tiefen der Unterwäschekunst und -tricks eingeweiht. Die Idee, man gehe mal kurz in einen Laden und kaufe sich einen selbstklebenden BH, wie naiv. Zunächst wurde mir demonstriert, wie man so einen selbstklebenden BH anzulegen habe. Schon befremdlich, wenn mit diesen beiden Teilen, die doch eigentlich immer in Verbindung stehen, so einzeln vor der Nase herumhantiert wird. Aufmerksam verfolgte ich die Handbewegungen (übrigens mitten im Geschäftsbetrieb, nicht in einem Séparée) und lauschte konzentriert den Anweisungen. Nicht vorher eincremen, fest andrücken, fast schon pressen und möglichst nicht schwitzen, denn sonst könnten die beiden „Schalen“ verrutschen. Die aufmerksame Verkäuferin entnahm meinem Gesichtsausdruck, dass mir bei dem Gedanken, ich bin mit diesem schönen Kleid und dem tollen Rückenausschnitt unterwegs und eine der Schalen verselbständigt sich, etwas sehr unwohl zumute wurde. Anstatt mich zu beruhigen, erzählte sie mir fröhlich, dass ihr das auch schon passiert sei, weil, klar, schwitzen könne man unter bestimmten Umständen einfach nicht vermeiden. Sie habe dann halt die Arme eng angelegt und die nächste Toilette aufgesucht, um die Haut abzutrocknen und alles wieder zu richten. Zaghaft fragte ich dann, ob es nicht eine Alternative gäbe. Klar, kam die prompte Antwort. Auf das Tragen eines BHs verzichten. Auf meinen Einwand, dass sich alles markiere, schlug sie mir vor, alles abzukleben. Meine Mimik drückte ganz sicher in diesem Moment noch mehr Missfallen aus und ich bereute schon insgeheim, dieses Kleid erworben zu haben und spielte mit dem Gedanken, es zurückzugeben. Der Gedanke, mich zu „verkleben“, um ein rückenfrei geschnittenes Kleid zu tragen, empfand ich doch mehr als befremdlich.
Während ich mich vorübergehend überfordert fühlte, übernahm es meine männliche Begleitung, das Problem zu lösen. Erschien es mir fast so, als entwickelte sich dieses Thema innerhalb der letzten Minuten zu einer sportlichen Herausforderung für ihn, mich irgendwie mit einem BH bekleidet, ohne dass man den Verschluss sieht, in dieses Kleid zu stecken. Nicht wenig erstaunt folgte ich dann dem Dialog zwischen meiner Begleitung und der hoch motivierten Verkäuferin, der dann noch als weitere Alternative einfiel, mit Hilfe eines Bandes, das man hinten am BH befestigte, diesen soweit herunterzog, dass der Verschluss sich nicht mehr im rückwärtigen Blickfeld des Ausschnittes befand. Die Enden des Bandes würde man dann vorne binden. An dieser Stelle lass ich jetzt einfach mal die Beschreibung meines Gesichtsausdrucks weg. Meine Begleitung war nicht mehr zu bremsen und ich vernahm, wie die Verkäuferin bedauerte, dass solche Bänder bei ihr nicht zu erwerben seien. Wir sollten in einen Dessous-Laden gehen. Kaum ausgesprochen verabschiedete man sich von der netten Verkäuferin und suchte den Dessous-Laden wieder auf. Dort trug ich mein Anliegen vor und was dann folgte, war ein absoluter Nachhilfeunterricht. Gott sei Dank war ich in die Hände einer nicht nur hoch motivierten, sondern ebenso fachlich kompetenten Person geraten, die mir die Idee mit den Bändern sofort ausredete, weil es natürlich auch die Vorderseite herunterzog (und wer will schon einen Hängebusen?) und es sich bei der Variante nicht wirklich um einen Tragekomfort handelte, wenn man irgendwo vorne etwas festbindet. Sie stellte mir ein paar Fragen zu Größe, Umfang, halt so das Übliche, schob mich in eine Umkleidekabine, forderte mich auf, das neu erworbene Kleid anzuziehen und den Rest sollte ich ihr mal überlassen. Ich fühlte mich auf einmal so geborgen und gut aufgehoben, dass ich mir ganz sicher war, diese Frau hatte die Lösung für mich und mein tolles Kleid.
Auch meine männliche Begleitung, die längst mit Spannung diese BH-Exkursion verfolgte und keine Anstalten mehr machte, schnell irgendwo hin zu müssen, wurde dann endgültig von dieser Perle von Verkäuferin ruhig gestellt, indem sie ihm ein Glas Sekt in die Hand drückte und ihm eine gemütliche Sitzposition präsentierte, von der aus er entspannt alles verfolgen konnte, was sich um meine Person oder besser ausgedrückt, um meinen Rücken herum, abspielte. Bei dieser Gelegenheit wurde ich zu den Themen Unterwäsche auf Ideen gebracht, die ich an dieser Stelle nicht weiter ausführen möchte. Immerhin lesen auch Männer meinen Blog und schließlich möchte ich hier nicht Geheimnisse der Frauenwelt offenlegen. Dabei wurde mir klar, dass die Frauen, obwohl es ihnen immer unterstellt wird, sich nicht wirklich ständig über alles miteinander austauschen. Wäre dem so gewesen, wäre ich sicher nicht so unglaublich unwissend in mein rückenfreies Abenteuer gestolpert.
Jetzt wollt ihr sicher wissen, wie ich das rückenfreie Problem gelöst habe. Ganz simpel. Mit einem entsprechenden speziellen BH, dessen Verschluss am hinteren Ende etwas weiter unten angesetzt ist und somit unter dem Ausschnitt verschwindet. Glücklich und leicht beschwipst, denn auch mir wurde zur Belohnung zwischen dem ständigen An- und Ausziehen Sekt gereicht, verließen wir den Laden, unterwäschetechnisch ausgerüstet für alle kniffligen Eventualitäten, die einem im Kleiderschrank noch so begegnen könnten. Ich fühlte mich tiefenentspannt und es macht mir überhaupt nichts mehr aus, dass dieser eigentliche Zwischenstopp sich mehr ausgedehnt hatte als geplant. Hatte ich -nein hatten wir- doch das Gefühl, an diesem Nachmittag wirklich mal wieder etwas dazu gelernt zu haben. Und das Kleid, na klar, das hatte längst seinen gebührenden Auftritt.
Ich sage nur. Ein schöner Rücken kann auch entzücken.
P.S.: Und übrigens: Nein, auf dem Foto ist nicht das Kleid aus meiner Geschichte zu sehen.
Claudia Lekondra
Vorurteile sind Wahrnehmungsfehler

Ein jeder hat Vorurteile außer ich, so denken doch die meisten von uns und man ist stets bemüht, sich tolerant und weltoffen zu geben. Und dann erwischt man sich auf einmal in einer Situation, in der man sich eingestehen muss, dass in einem sehr wohl eine vorgefertigte Meinung schlummert. Letztens war ich in meiner schönen weltoffenen und ach so toleranten Heimatstadt Berlin gegen ein Uhr nachts im Zentrum noch mit der S-Bahn unterwegs. Wie üblich waren um diese Uhrzeit die Zugwaggons in dieser Gegend der Stadt noch gut besucht, so dass man nicht die Möglichkeit hatte, einen Sitzplatz zu ergattern, sondern froh war, wenn man einen halbwegs bequemen Stehplatz fand. Ich stand in unmittelbarer Nähe einer der Waggontüren, als an einer Station ein Schwung schwatzender junger Leute in den Zug stieg. Während die Waggontüren gerade dabei waren sich zu schließen und die jungen Leute noch damit beschäftigt waren, durch Hin- und Hergeschiebe ihre Stehplätze zu sortieren, sprang ein großer fülliger arabisch aussehender Mann, in beiden Händen beladen mit mehreren Einkaufstüten einer Billigkleiderkette, in den Zug und blieb direkt an der sich schließenden Tür mit den Tüten in beiden Händen stehen und sagte :“Entschuldigung ich wurde festgenommen.“ Super, dachte ich, dass hat dir ja noch gefehlt: ein Verrückter nachts in einer völlig überfüllten S-Bahn. Da er in seiner Position verharrte, fühlte ich mich und einige andere Fahrgäste etwas in unserem schon sehr beengten Freiraum noch beengter.
Unauffällig musterte ich den neuen Fahrgast und schmulte in seine Taschen. Was, wenn der jetzt irgendetwas Verrücktes anstellt? Vielleicht hat er irgendwo sogar Sprengstoff. Würde sich doch super anbieten, nachts in einer überfüllten S Bahn einer so freiheitsliebenden Stadt einen Zugwaggon in die Luft zu sprengen. Ich sah schon förmlich die Schlagzeilen in der Tagespresse vor mir. Ich spürte, wie meine Anspannung zunahm. Oder was wäre, wenn er, gereizt durch den beengten Stehplatz, anfangen würde, in einer typischen aggressiven Araberart Stress zu machen?
Während die eine Hälfte von mir damit beschäftigt war, von Vorurteilen beflügelt, alle Schreckensszenarien durchzuspielen, nahm die andere Hälfte wahr, dass die Körperhaltung des massigen Mannes gehemmt wirkte, fast so, als würde er sich sehr unwohl in seiner Haut fühlen und sich ausschließlich darauf konzentrieren, während der Zug bei der Fahrt hin -und herschaukelte, nicht sein Gleichgewicht zu verlieren, da er, bedingt durch die Einkaufstüten in beiden Händen, nicht die Möglichkeit hatte, sich festzuhalten und aufgrund der Enge im Zug sich ihm auch nicht die Möglichkeit bot, auch nur eine seiner vielen Tüten abzustellen. Aber schon war die andere Hälfte von mir (die mit den Vorurteilen) zur Stelle und meldete sich: Na ist doch typisch: Attentätern sieht man schließlich nicht an, was sie vorhaben, genauso, wie man Verbrechern ihre Verbrechen nicht ansieht. Der Zug fuhr in den nächsten Bahnhof ein und ich ließ den stämmigen Mann aus meinem Augenwinkel nicht aus dem Blick. Als der Zug stand und die Türen sich öffneten, verließ er sofort seine Position an der Tür und drängte sich mit einem entschuldigenden und zugegebenermaßen sympathischen Lächeln an mir vorbei auf die andere Seite, so dass die anderen Fahrgäste ungehindert ein- und aussteigen konnten. Misstrauisch verfolgte ich ihn mit meinem Blick und sah, wie er ein Stück neben mir erleichtert einen nicht ganz so räumlich beengten Stehplatz fand. Unsere Blicke trafen sich und er lächelte mich erneut an, während er im gebrochenen Deutsch sagte: „Jetzt bin ich wieder frei.“ Ich schaute ihn irritiert an, woraufhin er die Tüten zu seiner rechten schwenkte und ich sah, dass eine der Tüten an einer Ecke am unteren Ende eingerissen war. „Ich konnte mich nicht bewegen,“ erklärte er dann noch und nun dämmerte mir, was geschehen war. Bei seinem Sprung in den Zug während sich die Türen schlossen, wurde eine seiner Tüten eingeklemmt, so dass er sich nicht von der Stelle bewegen konnte. Das war der Grund gewesen, warum er wie angewurzelt an der Tür stehen blieb. Und während er weiter fröhlich im gebrochenen Deutsch erzählte, dass er aus Ägypten zu Besuch in Berlin ist, wie toll die Stadt und Menschen seien und er morgen wieder nach Kairo fliege, musste ich mich und mein Gedankengut erst einmal unauffällig sortieren, während ich dort stand und ihm lächelnd zuhörte und er mir weiter fröhlich berichtete, wie anstrengend so ein Besuch sei, da es bei ihnen üblich ist, der ganzen Familie etwas aus dem Urlaub mitzubringen und er für diese Einkäufe allein zwei Tage unterwegs war. Er habe elf Geschwister und etliche Neffen und Nichten und so ging seine Erzählfreude im gebrochenen Deutsch zwei Stationen weiter. Bevor er ausstieg bedankte er sich bei mir, wohl stellvertretend bei allen Berlinern, für unsere Gastfreundschaft und für die tolle Zeit, die er in unserer Stadt verbringen durfte. Tief beschämt bei dem Gedanken, was ich ihm im Rausch meines Vorurteilswahns alles zugetraut hatte, sagte ich ihm, wie schön es war zu hören, dass er hier so eine tolle Zeit verlebt hatte und wünschte ihm einen guten Rückflug. Dann entschwand er in die Nacht und ich war einmal wieder froh, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, die Gedanken der anderen zu lesen. Wie peinlich wäre es mir gewesen, wenn dieser nette Mensch aus Kairo auch nur ansatzweise hätte erahnen können, was ich dachte. Ich verfluchte meine vorgefertigte Meinung. Ich habe mal gelernt, Vorurteile seien eine zutiefst menschliche Eigenschaft und fest in unserem Gehirn verankert. Während eines Seminars wurde ich mal darüber aufgeklärt, dass Vorurteile Wahrnehmungsfehler seien und schaden dem sozialen Zusammenleben. Oh wie wahr. Wenn ich so darüber nachdenke, dass mein Wahrnehmungsfehler über eine Zugstation lang andauerte und mich fast dazu gebracht hatte, in Panik auszubrechen. Diesen Ausbruch hätte ich dem netten Mann aus Kairo jedenfalls nicht sozialkompartibel erklären können.
Während der Zug weiter durch die Nacht rauschte, dachte ich an die Aussage eines Hirnforschers, der mal erläuterte, dass Vorurteile im Grunde ein Trick des Gehirns seien, um bei Informationsverarbeitung Energie zu sparen. Je schneller ein Mensch sein Umfeld einordnen kann, desto mehr Kapazitäten bleiben für andere Denkvorgänge und desto schneller kann es auf Gefahren reagieren. So gesehen hat also mein Gehirn hierbei alles richtig gemacht. Meine Vorurteile haben mich auf „Gefahrenmodus“ geschaltet, weil ein arabisch aussehender Mann mit Einkaufstüten beladen wie angewurzelt an einer Zugtür stehen blieb. Na prima. Zu meiner Verteidigung muss ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der andere Teil von mir, der, der nicht so vorurteilslastig arbeitete, in der Situation sehr wohl wahrgenommen hatte, dass der nette Mann aus Kairo gehemmt wirkte und den Anschein machte, sich in seiner Haut in dieser Situation nicht wohl zu fühlen. Damit lag ich ja vollkommen richtig. Wie hätte ich mich gefühlt, wenn ich diejenige gewesen wäre, die in einem fremden Land, mit Tüten eingeklemmt in einer Position verharren hätte müssen und mir vor lauter Schreck nicht die richtige Vokabel in der fremden Sprache eingefallen wäre, um den anderen Fahrgästen meine Situation zu erläutern. Immerhin hatte er sich ja beim Betreten des Zuges entschuldigt und darauf hingewiesen: „Ich wurde festgenommen“. Und hätte der eine Teil von mir bei seinem Anblick nicht gleich in den Vorurteilsmodus geschaltet, wäre es dem anderen Teil von mir möglich gewesen, die Chance zu nutzen, der Wahrnehmung weiter zu folgen, dass der nette Mann aus Kairo den Eindruck machte, sich unwohl zu fühlen. Dass er keinesfalls verrückt oder ein Attentäter war, sondern ein Tourist, der einfach eine nicht ganz so passende Vokabel wählte. Immerhin bin ich kein ganz hoffnungsloser Fall, was das Thema Vorurteile angeht und ich werde weiter daran arbeiten, sie abzulegen. Mich tröstet ein wenig der Satz von Arthur Schnitzler. Wer Vorurteile revidieren kann hat keine. Na also!
Claudia Lekondra
Was wäre wenn?

Was wäre gewesen wenn…die Frage hat sich ein jeder von uns sicher das eine oder andere Mal gestellt und je nach Lebenslage und –situation war das Gedankenspiel nach ein paar Minuten beendet oder man fand sich in einer wahren Lebenskrise wieder. Diese berühmte Frage, wann bin ich abgebogen, wo ich besser hätte geradeaus gehen sollen? Der Weg natürlich hier eine Metapher. Es geht um Dinge wie: die richtige Berufswahl, zu spät oder zu früh vom Partner getrennt, dabei vielleicht die Gelegenheit verpasst auf jemanden zu treffen, der besser zu einem passt. Die Frage, ob man das richtige Lebensmodel gewählt hat. Und immer wieder geht es um verpasste Chancen, weil wir vielleicht die falschen Entscheidungen auch in den alltäglichen kleinen Dingen getroffen haben, die aber dann irgendwann zu etwas ganz großem wurden. Um einzuschätzen, ob man eine falsche Entscheidung getroffen hat oder nicht, müsste man alle Tatsachen kennen. Um alle Tatsachen zu kennen, müsste man an mehreren Orten gleichzeitig sein oder die Möglichkeit haben, Dinge in allen Lebenslagen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Hat man zum Beispiel vor zu einem wichtigen Termin mit dem Auto zu fahren, muss man sich für eine Wegstrecke entscheiden. In meinem Beispiel besteht die Möglichkeit entweder die Haupt- oder die Nebenstraße zu nehmen. Unter normalen Umständen würde man das Ziel über die Hauptstraße schneller erreichen. Da man sich aber zur Rushhour auf den Weg macht, muss man davon ausgehen, dass die Hauptstraße um diese Zeit verstopft ist. So lange es aber zu keinem Stau kommt und der Verkehr fließt, würde man das Ziel dennoch in zwanzig Minuten erreichen. Die Nebenstraße ist etwas länger, aber nicht so befahren, wenn hier alles gut geht, würde man nach fünfzehn Minuten das Ziel erreichen. Auf der Nebenstraße gibt es aber in jede Fahrrichtung nur eine Fahrspur. Bei einem Unfall würde man hier länger festsitzen. Ganz klar zu erkennen: Beide Strecken haben ihre Vor- und Nachteile. Entscheidet man sich beispielsweise für die Hauptstraße und alles geht gut, man erreicht pünktlich sein Ziel, denkt man nie wieder über diese Entscheidung nach. Wenn man sich aber für die Hauptstraße entscheidet und es kommt dort zum Unfall, man steht eine Stunde im Stau und man verpasst seinen wichtigen Termin, denkt man in diesem Moment an die Nebenstraße und stellt sich die Frage, warum man sich nicht für die Nebenstraße entschieden hat und man glaubt in diesem Moment, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Aber warum denkt man das eigentlich? Man kann in diesem Moment nicht sehen, was auf der Nebenstraße los ist. Wie kann man dann wissen, ob die Entscheidung falsch war? Vielleicht ist auf der Nebenstraße ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt und hat ein Auto begraben und man würde jetzt statt einer Stunde dreieinhalb Stunden im Stau stehen. Oder noch schlimmer, es wäre das eigene Auto, das vom Baum getroffen worden wäre. Man würde im Stau auf der Nebenstraße stehen und sich die Frage stellen, warum man sich denn nicht für die Hauptstraße entschieden hat. Man kann in diesem Moment nicht wissen, was auf der Hauptstraße los ist, dass man dort ebenfalls im Stau stehen würde, zwar nicht so lange, wie auf der Nebenstraße, aber den wichtigen Termin würde man letztendlich, egal wie man sich entschieden hätte, verpassen. Aber vielleicht gab es auch auf der Hauptstraße keinen Stau und die Nebenstraße war tatsächlich die falsche Entscheidung oder umgekehrt.
Was ich mit diesem Beispiel sinnbildlich sagen will: Egal welche Entscheidung man im Leben trifft, wird man nie erfahren, ob es tatsächlich die richtige Entscheidung gewesen ist, weil ich nie wissen werde, wie es wäre, wenn ich mich für eine andere Variante entschieden hätte. Man wird nicht erfahren was wäre wenn…und vielleicht würde man im Ergebnis immer wieder im gleichen Leben, in der gleichen Geschichte landen, nur der Weg dorthin würde sich unterscheiden, egal welche Entscheidungen man wann getroffen hat. Vielleicht trifft man die Entscheidungen eben dann zu einer anderen Zeit mit dem gleichen Ergebnis…vielleicht aber auch nicht. Aber man kann eben immer nur aus der Situation des Moments oder Augenblicks für sich entscheiden.
Was wäre wenn? Wir werden nie eine Antwort finden.
Claudia Lekondra
Die wahre Definition vom Glück

Man braucht grundsätzlich Glück im Leben, darin sind sich sicher alle einig. Ohne das berühmte Quäntchen Glück im Leben scheitert man. Aber neben den äußeren Umständen hängt das Glücklich sein von der eigenen Einstellung ab. Neid und Missgunst stehen dem eigenen Glück im Weg. Mein eigenes Glück hängt nicht davon ab, ob die anderen mehr besitzen, aus meiner Sicht vielleicht sogar mehr Glück im Leben haben und zuversichtlicher durchs Leben spazieren. Mein Glück hängt von meiner persönlichen Einstellung, von meiner eigenen Wahrnehmung ab. Es geht um mich, nicht um die anderen. Es geht darum, wie ich mit mir umgehe. Denn diese Einstellung überträgt sich auf mein Umfeld und reflektiert sich unweigerlich auf mein Leben. Wenn man erst einmal akzeptiert und begriffen hat, dass man weder in der Vergangenheit, noch in der Zukunft, sondern nur in der Gegenwart glücklich sein kann, ist man auf dem richtigen Weg. Ich kann mich an glückliche Momente in meiner Vergangenheit erinnern und mich auch daran erfreuen, aber ich kann sie in der Gegenwart nicht fühlen. Es ist wichtig, im Leben zu planen und Ziele zu verfolgen, aber unser Glück kann nicht allein davon abhängen, diese Ziele zu erreichen, denn das würde bedeuten, dass wir immer nur für einen ganz kurzen Moment, nämlich während wir das Ziel erreichen, glücklich sind. Aber die Zeit dazwischen ist unser Leben, also müssen wir im Augenblick leben und das bedeutet, sich immer wieder auf das alltägliche Leben zu konzentrieren. Achtsamkeit ist der Schlüssel zu unserem Glück. Den Umgang mit der Achtsamkeit kann man lernen. Den Augenblick wahrnehmen in der Konsequenz, ihn nicht zu beurteilen, da eine Beurteilung schon die Wahrnehmung einschränken würde. Einfach mal auf das alltägliche Leben konzentrieren, nicht nur auf die großen Momente, auf Begegnungen und Gefühle warten. Wie viel Zeit erlaube ich mir selber bei den alltäglichen Dingen für die Achtsamkeit? Wie fühlt es sich an, morgens wach zu werden, unter der Dusche auf das Geräusch des Wasser achten, den Geruch des Shampoos und das Gefühl des Wassers auf der Haut wahrnehmen? Sich mal wieder ganz bewusst in den eigenen Vierwänden umschauen. Das Umfeld sehen, riechen, hören, schmecken…die Gegenwart eines Menschen genießen und dabei einfach die Gedanken außen vor lassen. Keine Antwort suchen auf warum, wieso, weshalb. Mit sich selber achtsam umzugehen, bedeutet sich wirklich zu fühlen. Klingt super in der Theorie, aber die Praxis schaut anders aus? Ja, da stimme ich zu. Es ist sicher nicht einfach und es hängt von jedem persönlich ab, ob und wie er bereit ist, sich mit der Achtsamkeit auseinanderzusetzen, um seinem persönlichen Glück einen Schritt näher zu sein. Versucht Euch doch mal an diesem Experiment mit der Wahrnehmung: Nehmt drei Schalen und füllt diese mit Wasser. Eine Schale füllt ihr mit badewannenheißem Wasser, eine mit lauwarmem Wasser und eine mit sehr kaltem Wasser. Dann legt ihr für ungefähr eine Minute eine Hand in das heiße und eine Hand in das kalte Wasser. Danach legt ihr beide Hände in das lauwarme Wasser und achtet dabei darauf, dass die Hände einander nicht berühren. Nicht wirklich eine Überraschung: Die Hände werden die Temperatur des lauwarmen Wassers ganz unterschiedlich empfinden. Was sollen wir aus diesem Experiment lernen? Viele Dinge hängen von unserer persönlichen Wahrnehmung ab, von dem, was wir vorher erlebt haben oder was wir erwarten. Auch wenn wir ganz sicher sind, dass unser spontanes Urteil ganz der Wahrheit entspricht. Wenn wir achtsam mit uns und unserem Umfeld umgehen, lassen wir zu, dass wir auf einmal anders fühlen als wir erwarten, lassen zu, dass wir die richtige Einstellung für die glücklichen Momente haben.
Vielleicht ist die wahre Definition vom Glück nicht zu wissen, dass man glücklich war und sich um nichts anderes zu kümmern hat, als im Jetzt zu leben?
Claudia Lekondra
Alt werden ist (k)eine Zumutung!

Das mit dem Alter ist so eine Sache. Als Kinder und Jugendliche können wir es kaum erwarten, älter zu werden.
Mit 20 denkt man, mit 50 ist man alt und alles was über 50 liegt, befindet sich nicht wirklich in der Wahrnehmung. Das Altwerden an sich scheint Lichtjahre von einem entfernt. Es geht einem ja
nur darum älter zu werden, um bestimmte Clubs besuchen zu können, ein Auto steuern zu dürfen und vor allem geht es einem darum, sich aus den Fängen der Erziehungsberechtigten zu befreien, was die
Vorgaben im alltäglichen Leben angehen. Das Bewusstsein des Älterwerdens erreicht einen erst später. Meist steht dieses Empfinden im Zusammenhang mit den persönlichen Wünschen und Zielen den
jeweiligen Lebensabschnitt betreffend. Hat man beispielsweise die Mitte dreißig erreicht und möchte heiraten und eine Familie gründen, aber es ist kein potentieller Partner hierfür in Sicht,
bekommt man vielleicht dann schon mal Angst, dass man zu schnell altert. Auch wenn man in diesem Alter gefühlt noch Lichtjahre von seinen beruflichen Zielen entfernt sein sollte, überkommt einem
vielleicht eine altersbedingte Unruhe und Panik. Und selbst wenn man sich mit dem persönlichen Alterungsprozess noch lange nicht beschäftigt, kommt man irgendwann an den Punkt, sich durch sein
familiäres Umfeld mit dem Altwerden dann doch auseinanderzusetzen. Wenn man die altersbedingten Veränderungen, sei es körperlich oder auch die Wesensveränderungen, bei Großeltern und Eltern
wahrnimmt, stimmt es einen nachdenklich. Die gesundheitlichen Einschränkungen nehmen zu und beeinflussen die Flexibilität und Mobilität. Als ich das erste
Mal ein Alterspflegeheim betrat und die an Demenz und Alzheimer erkrankten Menschen sah, war mir ganz merkwürdig zumute. Ich fragte mich, ob es unter diesen Umständen wirklich so erstrebenswert
ist, alt zu werden. Und ich bin mir sicher, wenn man die Betroffenen zu einer Zeit gefragt hätte, als sie über ihr Leben noch selber bestimmen konnten, hätten sie mit Sicherheit auch auf ein paar
Lebensjahre verzichtet, um sich und ihrem Umfeld diesen Lebensabschluss zu ersparen. Kürzlich habe ich einen sehr passenden Satz hierzu gelesen: Im Alterspflegeheim ist es wie nachsitzen: Die
Schule ist vorbei, aber man darf nicht gehen. Das Leben ist vorbei, aber man darf nicht gehen. Die, die das Glück haben zu denen zu gehören, die sich nur mit kleineren altersbedingten
körperlichen Defiziten auseinanderzusetzen haben, müssen oftmals eine Wesensveränderung hinnehmen, die von ihnen selber unbemerkt bleibt. Mit zunehmendem Alter schränkt sich der Blickwinkel auf
das Umfeld ein. Kleine Dinge des Alltags werden oftmals zu wahren Herausforderungen und die Welt um sie herum wird immer kleiner. Veränderungen bedeuten Unruhe und eine Art von Unsicherheit. Sie
sind dem Neuen gegenüber nicht mehr aufgeschlossen, sondern fühlen sich in der gewohnten Umgebung wohl und verlassen immer seltener das selbst erschaffene Umfeld. Ein Kreislauf, aus dem sie nicht
mehr herauskommen, setzt ein und lässt ihre Welt von Jahr zu Jahr schrumpfen. Und man steht erstaunt daneben und will die Veränderungen nicht wahrhaben und fragt sich, ob es sich tatsächlich um
die Menschen handelt, die früher lebensbejahend, interessiert und neugierig durchs Leben gingen.
Aber dann gibt es die Beispiele, die hoffen lassen, dass die Sache mit dem Altwerden doch ganz unterhaltsam
werden kann. Dass es trotz kleineren gesundheitlichen Einschränkungen möglich ist, flexibel und mobil zu sein, indem man eben nicht verlernt, neuen Eindrücken gegenüber offen zu sein, darüber zu
staunen und sich noch zu begeistern. So wie Opa! Opa ist 90 geworden und lebt nach wie vor in seiner
kleinen gemütlichen Wohnung. Er kümmert sich selbständig um seinen überschaubaren Haushalt, macht täglich seine Liegestütze, geht jeden Tag spazieren und pflegt sein soziales Umfeld in der
Nachbarschaft bei einer Tasse Kaffe und Frühstück beim Bäcker und dem einen oder anderen Bier im asiatischen Imbiss um die Ecke. Der alleinstehenden weiblichen Nachbarschaft seiner Generation
weicht er aus, da er keine Lust hat, sich über Krankheiten und andere Unbefindlichkeiten zu unterhalten. Hinzukommt, dass ihn ab und zu das Gefühl
beschleicht, die eine oder andere Dame versuche ihm schöne Augen zu machen. Nach solcher Art Kontakten stehe ihm überhaupt nicht mehr der Sinn. Luxus Problem mit 90! Wobei ich hier den Verdacht
hege, dass sich seine Meinung sofort ändern würde, wenn die Damen attraktiv, unternehmungslustig und noch in den Siebzigerin wären. Er schaut gern Reportagen, liest seine Tageszeitungen und hört
mit Vergnügen Musik. Er ist somit immer im Bilde, was gerade auf dieser verrückten Welt geschieht und fühlt sich weder bedroht noch beunruhigt. Sicher kann Opa auch anstrengend sein, wenn er
einen anpflaumt, weil man zum vereinbarten Zeitpunkt pünktlich zur vereinbarten Zeit erscheint und nicht ein paar Minuten vorher. Man muss ja schließlich nicht erst mit dem „Gongschlag“
erscheinen, schimpft er dann. Eine Diskussion darüber zu eröffnen, dass man pünktlich ist, wenn man mit Gongschlag zum vereinbarten Zeitpunkt erscheint, wäre überflüssig und ich bin mir nicht
sicher, ob diese Betrachtungsweise der Pünktlichkeit mit seinem Alter zu tun hat oder es sich hier mehr um eine persönliche Eigenart handelt, die einem zuvor nicht aufgefallen
war.
Er sprüht auch gern vor Lebensweisheiten der besonderen Art. Zum Beispiel erkundigten wir uns
nach einem gemeinsamen Abend, bei dem ordentlich Alkohol geflossen war, am nächsten Tag besorgt, ob es ihm denn gut ginge, woraufhin er von sich gab: „Ja natürlich. Warum soll es mir nicht gut
gehen? Ich musste ja schließlich nicht arbeiten und betrunken war ich doch nicht gewesen. Ich musste mich ja nicht übergeben“. Diese Aussage lasse ich jetzt einfach mal
unkommentiert.
Letztens tanzte er auf einer Party zu Liedern, die er vermutlich noch nie gehört
hatte, deren Rhythmus und Gesang ihm teilweise fremd waren, aber er erfreute sich an den Partygästen, die um ihn herum schwirrten. Als man ihn bewundert
darauf ansprach, wie toll es sei, dass er in seinem Alter noch tanzte und dann noch zu dieser Musik, erklärte er nur kühn: „Na ich kann doch nicht den
ganzen Abend herumsitzen.“ Ein Satz von ihm, der einfach dem Moment geschuldet war und über den er sicher auch nicht weiter nachgedacht hatte, denn das wäre untypisch für ihn. Für mich bringt
dieser Satz seine Lebensphilosophie zum Ausdruck und hinter dieser Philosophie verbirgt sich sein Geheimnis, wie man mit 90 noch so gut beieinander sein
kann. Wie immer im Leben gehört natürlich Glück dazu, ganz klar und dann muss man mit zunehmendem Alter halt dafür sorgen, dass man nicht nur herumsitzt, sondern ab und an einfach
mittanzt.
Claudia Lekondra
Durch die Leidenschaft lebt der Mensch,

durch die Vernunft existiert er nur. Was für ein Satz von Nicolas Chamfort. Aber ist dem so? Stellt sich erst einmal die Frage, was man unter Leidenschaft versteht. Hierzu mal wieder den Duden befragt, erklärt dieser die Leidenshaft so:
-
„sich in emotionalem, vom Verstand nur schwer zu steuerndem Verhalten äußernder Gemütszustand (aus dem heraus etwas erstrebt, begehrt, ein Ziel verfolgt wird)
-
große Begeisterung, ausgeprägte [auf Genuss ausgerichtete] Neigung, Passion für etwas, was man sich immer wieder zu verschaffen, was man zu besitzen sucht, für eine bestimmte Tätigkeit, der man sich mit Hingabe widmet,
-
sich in starkem Gefühl, in heftigem, ungestümem Besitzverlangen äußernde Zuneigung zu einem Menschen.“
Leidenschaft ist also nicht logisch. Um sie zu spüren und zu leben, muss man sie zulassen, den Verstand ab und an zurückdrängen. Nichts bereuen, nicht immer alles erklären, sondern dieses Gefühl annehmen und leben. Man kann Leidenschaft in Verbindung zu einem Menschen empfinden und leben, oder zu einer Sache, wie Musik, Schauspiel, Lesen, Schreiben, Tanzen, Sport und manchmal sogar für die Arbeit. Leidenschaft bedeutet Spaß, Kraft, Antrieb und pure Freude ohne Gegenleistung. Ich schreibe aus Leidenschaft, ich fotografiere aus Leidenschaft und ich tanze aus Leidenschaft. Dies sind alles Dinge, die ich auch ohne Gegenleistung immer tun werde. Also Dinge, mit denen ich weder unbedingt Geld verdiene, noch hierfür ständig Anerkennung erfahre. Ebenso verhält es sich mit der Leidenschaft in Verbindung zu Menschen. Man kann für eine Person eine romantische Leidenschaft empfinden, ohne dass diese erwidert wird. Es beginnt meistens mit einer Anziehungskraft, daraus entwickelt sich eine Spannung, die von einer gewissen Distanz und dem Reiz des Unbekannten lebt. Es gibt romantische leidenschaftliche Verbindungen zwischen zwei Personen, die beidseitig empfunden werden und denen es gelingt, eine Vertrautheit zu entwickeln und sich dennoch die geheimnisvolle Distanz und Spannung zu bewahren. Und dann gibt es die leidenschaftliche Verbindung zu Menschen außerhalb von romantischen Gefühlen. Hierbei geht es oftmals um den Zusammenhang mit einer gemeinsamen Tätigkeit, um die Art der Verbindung zu einem Menschen, denn Leidenschaft hat immer etwas mit Verbindungen zu tun. Es geht um das Miteinander. Es geht hierbei nicht um das Warum, sondern darum sich gut zu fühlen, es geht um das Was, nicht um das Wie. Menschen, die einen begeistern, die etwas in unserem Leben bewirken, die uns inspirieren. Es geht um ein gutes Gefühl bei richtiger Dosis.Und manchmal verbinden sich die beiden Arten der Leidenschaften miteinander.
Leidenschaft ist ein Gefühl, das auftaucht und gelebt werden will. Leidenschaft hat eine eigene Sprache. Leidenschaft geht in die Tiefe. Vielleicht ist diese Tiefe, dieses Gefühl etwas nicht wirklich kontrollieren zu können, weil die Vernunft hierbei verloren geht, der Grund, dass Menschen mit ihrer Leidenschaft nicht umgehen können, dass sie dieses Gefühl nicht einfach genießen, weil sie immer und immer wieder versuchen, es zu steuern, anstatt es einfach zuzulassen und sich daran zu erfreuen. Einfach dem Leben so etwas Würze geben, es etwas bunter machen, damit sich das Leben auch außerhalb der Leidenschaften besser anfühlt.
Durch die Leidenschaft lebt der Mensch, da stimme ich Monsieur Chamfort zu. Durch die Vernunft existiert er nur? Wenn man das Wort „nur“ weglässt, würde ich auch hier mit ihm übereinstimmen.
Also tanzt und singt, malt und liebt und was auch immer in Euch die Leidenschaft weckt. Wahre Leidenschaft überdauert kurzfristige Begeisterung.
Claudia Lekondra
Genau jetzt

Um unseren Alltag optimal zu nutzen, sind wir unweigerlich ständig damit beschäftigt zu planen. Anders würde man das Familien- und Berufsleben sowie auch seine sonstige Freizeitgestaltung nicht wirklich organisiert bekommen. Ständig wird davon geredet, wie kostbar die Zeit ist. Und gerade deswegen versuchen wir eben, unsere Zeit bestmöglich zu planen.
Irgendwann ist mir aufgefallen, dass man sich manchmal zu viel mit der Zeit beschäftigt und man sich im Jetzt verliert. Wenn ich während des Hauptganges im Restaurant bereits darüber nachdenke, ob ich noch ein Dessert nehmen werde, wenn man sich freut auf jemanden zu treffen und bei der Begrüßung schon darüber nachdenkt, sich wieder verabschieden zu müssen, wenn man den Urlaub antritt und sich darüber Gedanken macht, dass die Tage wieder viel zu schnell vergehen werden, wenn man beim Einschlafen überlegt, wie viel Zeit einem für den Schlaf bleibt, wenn man ein schönen Moment erlebt, einen Augenblick, den man festhalten möchte, den man genießt, auskostet, aber im Hinterkopf schon bedauert, dass er vergehen wird… dann lebt man nicht im Jetzt.
Vielleicht haben diese Überlegungen und Empfindungen etwas mit der Lebenszeit zu tun, die man hinter sich gelassen hat, wenn einem bewusst wird, dass bereits mehr Zeit gelebt ist, als man vermutlich noch zu leben hat. Man begreift auf einmal, dass die Zeit an sich nicht kostbar ist, sondern das, was außerhalb der Zeit liegt: das Jetzt!
Wenn ich mich ständig mit der Zeit beschäftige, ob nun mit der Vergangenheit oder der Zukunft, verpasse ich das Jetzt.
Vielleicht ist es zu spät, vielleicht es ist zu früh, vielleicht ist es genau jetzt...
Claudia Lekondra
Männer im Kerzenschein

Für meine Romane brauche ich Protagonisten, denen ich Leben einhauche, damit ich meine Geschichten erzählen kann. Eine Grundvoraussetzung hierfür ist, dass ich die Menschen beobachte und versuche, ihnen sehr genau zuzuhören. Das gelingt mir seit meiner Kindheit glaube ich ganz gut, so war und ist es mir möglich Charaktere zu entwickeln, mich in sie rein zu denken und sie in meinen Büchern agieren und reagieren zu lassen. Aber ich kann eben immer nur davon lernen, was ich sehe und höre; was bedeutet: Eben nur das, was die Menschen von sich im alltäglichen Miteinander preisgeben. Aber es gibt Themen, da ist es nicht so leicht auszumachen, was die Menschen wirklich bewegt. So befinde ich mich gerade in meinem aktuellen Roman an einer Stelle, wo ich mir die Frage stelle, sind Männer eigentlich romantisch? Natürlich habe ich zu diesem Thema eine Meinung, die ich aus meinen Wahrnehmungen und meinen Erfahrungen mit Männern gebildet habe, aber es ist meine Meinung, meine Wahrnehmung und meine Erfahrung, die keinesfalls bedeutet, dass diese repräsentativ und aussagekräftig ist. Die Schwierigkeit ist unter anderem einzuschätzen, ob Männer bestimmte Situationen und Momente ebenfalls romantisch empfinden oder es nur den Anschein hat. Wer antwortet schon ehrlich, wenn man beieinander sitzt (oder liegt oder läuft oder was auch immer) und gefragt wird: Findest Du es auch gerade romantisch? Jetzt höre ich schon, wie die Frauenwelt an dieser Stelle in Aufruhr gerät, weil sie mir mitteilen will, dass der eine oder andere Herzbube in genau so einer Situation durchaus in der Lage ist/war, ehrlich und höchst unromantisch zu antworten, dass er eben diesem Moment keinerlei romantische Gefühle abgewinnen kann. Männer im Beisein anderer Männer zu befragen ist auch nicht hilfreich, weil da die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass Mann nicht als Weichei dastehen will und uns dann von Testosteron gesteuert verkündet: Ach Romantik, sexy Unterwäsche, leckeres Essen und wir gehören Euch. Wir brauchen keine Kerzen, Kitsch und Liebesschwüre. Puh, halt die ganz schwierigen Fälle, denn hier wäre erst einmal Aufklärung darüber zu betreiben, dass weder Kerzen, Rosen, Rotwein noch ein offener Kamin automatisch Romantik bedeuten. Es geht nicht darum, was Du tust, sondern wie und warum. Was bedeutet Romantik, was ist romantisch in der eigentlichen Bedeutung des Wortes? Duden hierzu befragt und er klärt uns auf: gefühlsbetont, schwärmerisch, idealisierend, geheimnisvoll, malerisch, reizvoll. Erklärt sich von selbst, dass eine Kerze, eine Flasche Rotwein und ein Kamin eben nicht ausreichen, um romantisch zu sein. Schließlich kann man mit mehreren Freunden bei Kerzenschein und einer Flasche Rotwein am Kamin sitzen und es ist eben nicht romantisch, sondern gemütlich. Bei der romantischen Empfindung kommt es darauf an, mit wem, wie und eben warum man beisammen ist. Also stellte ich Männern unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Frage: Sind Männer eigentlich romantisch? So erhielt ich zum Beispiel von einem Herrn die Auskunft, dass es völlig ausreichend sei, mit dem anderen Geschlecht bei gedimmtem Licht zusammenzusitzen. Die Idee hier nun auch noch ein Teelicht oder eine Kerze anzuzünden, liege ihm eher fern. Er schätzte sich hierbei nicht als Herzblutromantiker ein, sondern empfand sich selber als eine gesunde Zwischenlösung. Auf die Frage, was er denn persönlich als romantisch empfinde, erhielt ich zwar dann die platte und weit verbreitete Antwort: Sonnenuntergänge und so, wobei auch hier der Hinweis erfolgte, dass er zwar einen Sonnenuntergang etwas abgewinnen könne und grundsätzlich die Stimmung als romantisch einstufen würde, er aber nicht die Notwendigkeit erkenne, beispielsweise während eines Strandurlaubes jeden Tag den Sonnenuntergang betrachten zu müssen. Ein Sonnenuntergang innerhalb von vierzehn Tagen reicht hier aus. Diesen Herrn würde ich mal als ansatzweise romantisch einstufen, mit ausbaufähigem Potential.
Die meisten Männer empfinden sich nicht als romantisch, sind aber – von sich selber völlig unbemerkt- durchaus als romantisch zu bezeichnen. Wenn mir mehr oder weniger zögerlich erzählt wird, dass man natürlich nicht romantisch ist, aber es käme darauf an mit wem man zusammen sei. Eine romantischere Aussage geht kaum. Wenn mir ebenfalls sehr zurückhaltend gestanden wird, dass so ein Spaziergang am Strand schon für Herzklopfen sorgt, wenn die Richtige neben einem läuft, dass es schön ist, einfach nebeneinander im Gras zu liegen und in den Himmel zu schauen, im Regen spazieren zu gehen oder einfach gemeinsam die Straße entlang zu laufen, dabei die Sonne einem ins Gesicht scheint, ein leichter Wind weht, dabei eine versehentliche Berührung… eigentlich ein belangloser Moment, den man spontan anhalten möchte und man stellt auf einmal fest oder wird darin bestätigt, der Mensch neben mir bedeutet mir etwas, ich fühle mich gut, genau jetzt…meine Herren, mehr Romantik geht kaum, auch wenn ihr Euch dessen offensichtlich selber nicht bewusst seid. Wenn es Euch nun noch gelingt, diejenige welche, die an Eurer Seite diese Gefühle bei Euch auslöst, auch daran teilhaben zu lassen und es eben nicht für Euch still und leise als Gefühlsduselei einstuft und schweigt, hätte sich die Frage „sind Männer romantisch“ für mich nie gestellt.
Ihr seid romantisch, auch wenn Ihr nicht daran denkt, Teelichter und Kerzen aufzustellen und anzuzünden. Wir Mädels zünden uns die Teelichter und Kerzen weiter selber an, schaffen dazu ein Six Pack zur Sportschau oder zu Eurem absoluten Lieblingsactionthriller ran und weinen mit Euch gemeinsam beim Gladiator. Wenn das nicht romantisch ist!!!
Zu guter Letzt dann doch noch eine persönliche Anmerkung von mir zum Thema Romantik, aus Sicht einer Frau halt: Romantik ist auch ein Stück weit Sehnsucht, trägt sich durch Spontanität in kleinen Gesten und Ungewissheit, um mit den Worten von Anselm Vogt zu schließen: Der Romantiker erreichte sein Ziel, denn er kam niemals an.
Claudia Lekondra
Die ersten Tage im Januar

Die ersten Tage im Januar fühlen sich für mich immer etwas verkatert an. Nicht, dass ich wirklich an einem klassischen Kater (Kopfschmerzen und allgemeines Unwohlsein, hervorgerufen durch den Konsum von zu viel Alkohol oft in Verbindung mit zu wenig Schlaf) leide. Es überkommt mich in den ersten zwei drei Tagen im neuen Jahr oft eine merkwürdige gedrückte Stimmung. Die Ursache glaube ich darin zu sehen, dass es in den beiden letzten Wochen des Jahres bei mir immer besonders triebig und bunt ist. Da sind zum Beispiel die Weihnachtsfeiern und traditionellen Treffen mit Freunden, bevor das Jahr vorbei ist. Ein Weihnachtsmarktbesuch, auch wenn man kein Freund davon ist, wird auch noch mit eingeplant. Das ganze Jahr über trifft man nicht so geballt auf Freunde und Familie, wie in den letzten zwei Wochen des Jahres. Zwischen den Jahren plant man noch spontan Silvester. Eigentlich will man ja nicht so auf Knopfdruck feiern, aber wenn dann der 31.12. bedrohlich näher rückt, will man ja dann doch irgendwie. Und dann ist alles wieder vorbei. Weihnachten, Silvester und überhaupt das ganze letzte Jahr. War es einem doch so vertraut. Nun fühlt sich alles so neu an. Eigentlich völliger Blödsinn. Es geht einfach alles weiter. Ein ganz normaler Monatswechsel. Also überhaupt kein Grund Trübsal zu blasen und dennoch fallen mir die ersten zwei drei Tage im neuen Jahr schwer. Wie sagte Albert Einstein so schön: „Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue Dich aufs Neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht.“ Wie wahr und dennoch blinzel ich etwas misstrauisch dem neuen Jahr entgegen und warte auf das Gefühl, dass es mir vertraut wird. Aber ich bin zuversichtlich. Heute ist das Jahr bereits sieben Tage alt und es ist mir nicht mehr ganz so fremd.
Ich wünsche allen ein gesundes und glückliches Jahr 2018!
Claudia Lekondra
Gewohnheit, Sitte & Brauch ...

Nun ist es endlich soweit. Die weihnachtliche Beleuchtung auf den Straßen und in den Schaufenstern der Geschäfte wird angeschaltet und lässt so die dunkle Jahreszeit etwas heller und freundlicher erscheinen. Adventszeit! Endlich kann Zuhause wieder im Keller und auf Dachböden in den Kisten mit der Aufschrift „Weihnachtsdekoration“ gestöbert werden. Entzückt verteilt man seine mühevoll in den Jahren zusammengetragene Weihnachtsdekoration im Haus oder Wohnung und kommt oftmals nicht umhin, auch in dieser Weihnachtssaison während der Weihnachtseinkäufe seine Dekorationssammlung zu erweitern. Hierbei ist es im Übrigen egal, ob man, wie früher üblich, durch die Geschäfte und Kaufhäuser stöbert und dort den neuesten Dekorationstrend begegnet oder ob man sich von der Welt da draußen zurückzieht und sich beim Weihnachts-Shoppen im Internet bewegt. Die Versuchungen lauern überall. So schauen wir erfreut der vorweihnachtlichen Zeit entgegen, die mit den alle Jahre wiederkehrenden Aufgaben und Events auf uns wartet mit dem Ziel, dass bis Heiligabend alles erledigt ist und wir uns entspannt den Weihnachtsfeiertagen widmen können. Dass diese Feiertage oftmals eine wahre Herausforderung sind und der eine oder andere Tag so gar nichts mit Entspannung zu tun hat, muss an dieser Stelle sicher nicht extra erwähnt werden. Die Weihnachtsgegner unter Euch werden jetzt sicher rufen: genau, und darin einmal mehr ihre Bestätigung finden, warum sie Weihnachten und alles drum herum ablehnen. Auf die jeweiligen Argumente, warum man dafür oder dagegen sein kann, will ich hier nicht eingehen. Vielmehr geht es mir um die Frage, was einem jeden Einzelnen Weihnachten bedeutet. Abseits von dem, was uns die Religion und der Kommerz versuchen einzureden. Mal losgelöst von negativen Erfahrungen, jährlich wiederkehrenden Erwartungen und anerzogenen Traditionen.
In den letzten Wochen habe ich mich mal umgehört und nachgefragt: Was bedeutet Dir persönlich Weihnachten? Interessant hierbei, dass ich immer wieder zu hören bekam, dass es eben die Traditionen sind, die hier einen hohen Stellenwert haben, denen man gern folgt und die man mit den Menschen teilt, die man liebt. Ist es wirklich immer möglich, Weihnachten mit den Menschen zu verleben, die man liebt? Und wenn das nicht möglich ist, ist Weihnachten dann weniger Wert? Was bedeutete einem dann Weihnachten? Haben in unserem Leben nicht längst andere Gewohnheiten und andere Menschen ihren Platz gefunden, die einem ebenso wichtig sind? Kann man Weihnachten nicht los lösen von Traditionen? Ist es nicht möglich, Weihnachten getrennt von Überlieferungen, Bräuchen und Sitten zu betrachten?
Ich habe bei meinen Gesprächen über Weihnachten herausgehört, dass die Menschen sich eben mit den weihnachtlichen Traditionen so vertraut und wohl fühlen, dass Traditionen im Zusammenhang mit Weihnachten tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil sind und dass das Leben im Alltag oft Überraschungen und Wendungen für uns bereit hält, so dass man sich einmal im Jahr für ein paar Tage ganz sicher sein möchte, was auf einen zukommt, während uns eine Stimme leise ins Ohr flüstert: Gewohnheit, Sitte & Brauch sind stärker als die Wahrheit.
Jetzt wollt ihr wissen, was Weihnachten mir persönlich bedeutet? Was Weihnachten für mich ist: Das Gefühl, dass sich die Welt für ein paar Tage etwas langsamer dreht.
Claudia Lekondra
Fotos sind Momentaufnahmen

Ich liebe es zu fotografieren! Durch die Welt zu spazieren und innezuhalten, wenn man etwas entdeckt, was die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Nicht nur auf Reisen, sondern auch im alltäglichen Leben. Auf dem Weg zur Arbeit, im Restaurant, beim Spazierengehen oder unterwegs mit Freunden. Manchmal ist es nur ein Tasse, die vor einem besonders schönen Hintergrund steht oder ein Glas, das auf wunderbare Weise einen Sonnenstrahl einfängt. Oder man ist selber das Motiv. Manchmal ist es ein bestimmter Blickwinkel in einem bestimmten Lichtverhältnis, der eben genau aus diesem Winkel eine besondere Perspektive ermöglicht, die man, wenn man sich etwas nach links oder rechts, nach oben oder unten bewegt, nicht mehr wahrnimmt. Es sind diese Momente, die nur einen kurzen Augenblick dauern, aber die man einfangen möchte. Wofür? Warum?
Ich möchte diesen Moment festhalten, die Zeit, eben diesen Augenblick, als Mittel gegen das Vergessen. Bei der Entdeckung des Motives entscheide ich, was ich davon einfangen möchte, wie es dem Betrachter später erscheinen soll. Was links und rechts davon, eine Sekunde zuvor oder danach ist, wird ausgeblendet. Ich halte auf dem Foto das fest, was ich in diesem Moment sehe und fühle, aus meinem Blickwinkel erzählt das Foto etwas. Eine Geschichte, ein Gedicht, einen Satz, vielleicht flüstert das Foto auch nur ein Wort. Und jedem Betrachter erzählt es etwas anderes, weil jeder etwas anderes in das Foto hinein interpretiert. Es gibt Fotos, bei deren Betrachtung ich mich auch nach dreißig Jahren genau erinnere, wie ich mich damals fühlte; genau in diesem Augenblick, in dem das Foto entstand. Mit den Jahren geht die Erinnerung an die Geschichte um das Foto herum mitunter verloren. Fotos von damals in schlechter Qualität aufgenommen aus dem Augenblick heraus, denn damals drückte man nicht für ein Motiv zwanzigmal auf den Auslöser. Sind die Fotos von früher näher an der Realität? Oder eben nicht, weil der eigentliche Moment eine Sekunde zuvor oder danach war und man eben diesen nicht eingefangen hat? Sind wir heute näher an der Realität, weil wir aus den zwanzig digitalen Aufnahmen von genau diesem Moment die Perspektive auswählen können, die unser Gefühl am ehesten wiederspiegelt?
Ich fotografiere, um den Moment für mich festzuhalten, für meine Erinnerung, weil das Bild mir etwas erzählt, vielleicht eben nur eine Betrachtungsweise, die ich eben diesem Foto durch die Art und Weise meiner Aufnahme mitgebe, aber es ist meine Geschichte und manche Bilder teile ich mit Euch, weil sie – ähnlich wie meine Texte – eben etwas erzählen. Manche Fotos entstehen extra für meinen Blog, weil die jeweiligen Bilder den Inhalt meines Blogs unterstützen. Aber es gibt auch Motive, die sich vor meiner Kamera auftun, die mich inspirieren, darüber zu schreiben, was ich sehe, was ich fühle.
Das Foto von diesem Blog ist auf dem Weg von Berlin nach Hamburg vor zwei Wochen entstanden. Es war in seiner Entstehung nicht für den Blog gedacht. Ich war gefangen von diesem unglaublich schönen Blick, von diesem Licht, dieser Reflexion… Dieser Moment war es, an dem ich wusste, worüber ich meinen Blog schreiben würde: Fotos sind Momentaufnahmen für die Ewigkeit und manchmal können Fotos eben auch ein Gedicht ohne Worte sein.
Henri Cartier Bresson (französischer Fotograf) sagte einst: Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut.
Wie viele Sekunden schaut Ihr auf das Autobahn-Foto? Wenn Ihr es länger als eine Sekunde betrachtet, ist es demnach ein gutes Foto und es erzählt jedem von Euch eine andere Geschichte.
Claudia Lekondra
Der Sommer, als der Regen kam

Eigentlich fing die Sache mit dem Wetter in diesem Jahr (meine Berechnungen hierzu beginnen im April – vorher versucht man immer den Winter möglichst schnee- und eisfrei zu überstehen) ganz gut an. Da erfreute ich mich im April bereits an ein paar sonnigen Tagen und sah zuversichtlich dem Sommer 2017 entgegen. Und dann wartete ich. Zunächst dachte ich, wird schon noch werden. Es war ja nicht kalt, aber auch eben nicht richtig sommerlich warm und einfach zu nass. So hoffte ich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat auf meine schönen Sommertage und lauwarmen Sommernächte. Nicht, dass es gar keine Sonne und nicht mal die einen oder anderen schönen Sommerabende gab, aber die, die sich dann erfolgreich durchsetzen konnten, waren an einer - vielleicht je nach Region – oder zwei Händen abzuzählen. Stattdessen ging der Sommer im wahrsten Sinne des Wortes (im Regen) unter. Nicht etwa in vielen kurzen heftigen Sommerregengüssen, nein, man war ja irgendwann dankbar, wenn der einen ganzen Tag lang anhaltendende Starkregen eine ausreichende Pause einlegte, so dass man beim Beseitigen der Wasserschäden trocken blieb, und dass das Wasser eine Chance hatte, irgendwohin abzulaufen. So saß ich an den langen hellen Abenden drinnen und beobachtete mitunter nicht ganz unbeeindruckt die Wassermassen, die vom Himmel fielen und ich dachte immer, irgendwann muss es doch da oben „alle“ sein. Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber ich fühle mich um den Sommer 2017 betrogen. Erfreulicherweise hatte ich gerade für zwei Wochen die Möglichkeit, mir den Sommer in Andalusien zurückzuholen. Zwei Wochen Sonnenschein, blauer Himmel bei dreißig Grad…warme Sommernächte. Zum ersten Mal dachte ich ernsthaft darüber nach auszuwandern, sozusagen der Sonne entgegen. Irgendwie fühlt sich das Leben bei Sonnenschein und Wärme gelassener an. Aber glücklicherweise zähle ich zu den Menschen, die nach dem Motto leben: was ich nicht persönlich ändern kann, muss ich hinnehmen und diese Einstellung hat mir beim Paddeln durch den Sommer geholfen.
Nun lehne ich mich entspannt zurück und warte auf den von den Meteorologen versprochenen Indian Summer. Schließlich war ich die letzten Monate in Geduld geübt, von Tag zu Tag auf den Beginn des versprochenen Sommers zu warten. Bin ja schließlich ein Optimist und froh darüber, dass der Regen im Sommer kam. Stellt Euch doch mal vor, es wäre Winter gewesen und der Regen wäre als Schnee auf uns nieder gefallen…in diesem Sinne wünsche ich Euch einen schönen Herbst.
Claudia Lekondra
Was ein Blumentopf, Sand, Kieselsteine, Golfbälle und ein Bier mit den wirklich wichtigen Dingen im Leben zu tun haben.

Vor Jahren las ich einmal die Geschichte über einen Philosophieprofessor, der mit einigen Gegenständen vor seine Klasse trat. Zum Unterrichtsbeginn nahm er wortlos einen sehr großen Blumentopf und begann, diesen mit Golfbällen zu füllen. Er fragte dann seine Studenten, ob der Topf nun voll sei. Sie bejahten es. Dann nahm der Professor ein Behältnis mit Kieselsteinen und schüttete diese in den Topf. Er bewegte den Topf sachte und die Kieselsteine rollten in die Leerräume zwischen den Golfbällen. Dann fragte er seine Studenten wiederum, ob der Topf nun voll sei. Sie stimmten zu. Als Nächstes griff der Professor nach einer Dose mit Sand und schüttete diesen in den Topf. Natürlich füllte der Sand den kleinsten verbliebenen Freiraum. Und wieder stellte er seinen Studenten die Frage, ob der Topf nun voll sei. Die Studenten antworteten wieder einstimmig mit „Ja“. Nun holte der Professor zwei Flaschen Bier unter dem Tisch hervor, schüttete den ganzen Inhalt in den Topf und füllte somit den letzten Raum zwischen den Sandkörnern aus. Ihr stellt Euch jetzt sicher die gleiche Frage, wie die Studenten: was sollte das Ganze?
Der Topf ist als Repräsentation Eures Lebens anzusehen. Die Golfbälle sind die wichtigen Dinge in Eurem Leben: Eure Familie, Kinder, Gesundheit, Freunde und die bevorzugten, ja leidenschaftlichen Aspekte des Lebens, durch welche, falls in Eurem Leben alles sonst verloren ginge und nur noch diese verbleiben würden, Euer Leben trotzdem noch erfüllend wäre. Die Kieselsteine symbolisieren die anderen Dinge im Leben wie Arbeit, Haus, Auto. Der Sand ist alles andere, die Kleinigkeiten. Falls der Sand zuerst in den Topf gegeben wird, hat es weder Platz für die Kieselsteine noch für die Golfbälle. Dasselbe gilt für Euer Leben. Wenn Ihr all Eure Zeit und Energie in Kleinigkeiten investiert, werdet Ihr nie Platz haben für die wichtigen Dinge.
Und jetzt fragt Ihr Euch sicher, was denn das Bier repräsentieren sollte. Nichts. Der Professor wollte nur darauf hinweisen, dass, egal wie schwierig das Leben auch manchmal sein mag, immer noch Platz für ein oder zwei Bierchen ist.
Also achtet auf die Golfbälle, der Rest ist nur Sand. In diesem Sinne: Prost und genießt den September mit Golfbällen.
Claudia Lekondra
Kreativität ist eine Frage der Inspiraton von außen

Letztens fragte mich jemand, woher ich meine Kreativität nehme. Meine spontane Antwort lautete: Sie ist halt da, sie begegnet mir überall. Für den einen oder anderen, der das hier liest, eventuell nachvollziehbar, dass mich mein Gegenüber etwas irritiert oder besser ausgedrückt verständnislos anschaute und keine weiteren Fragen hierzu stellte. Ganz offensichtlich hatte mein Gesprächspartner das Interesse an einer Fortsetzung der Unterhaltung zu diesem Thema verloren. Vermutlich davon ausgehend, dass von einer kreativen künstlerisch veranlagten Person – wie meiner Person- eben keine – für den „normalen“ Menschen – verständliche Antwort zu erhalten ist. Mir hingegen ließ diese Frage keine Ruhe und ich dachte darüber nach, ob meine Antwort nicht etwas zu platt gewesen war. Also fragte ich mich erst einmal: Was ist eigentlich Kreativität? Wie lautet die genaue Definition? Und natürlich bin ich schnell fündig geworden: Kreativität bezeichnet die Fähigkeit einer Person, in phantasievoller und gestaltender Weise zu denken und zu handeln. Aha. Und weiter ging es im Text: Kreativität ist die zeitnahe Lösung (Flexibilität) für ein Problem mit ungewöhnlichen, vorher nicht gedachten Mitteln (Originalität) und mehreren Möglichkeiten der Problemlösung (Ideenflüssigkeit), die für die Person vor der Problemlösung in irgendeiner Weise nicht denkbar ist (Problemsensitivität). Puh!
Klingt verwirrend, doch wenn man die Erklärung erst einmal sacken lässt, stellt man fest, dass demnach jeder Mensch kreativ ist, beziehungsweise sein kann. Oftmals wird Kreativität immer nur im Zusammenhang mit der Kunst und deren Künstler gesehen. Die meisten Menschen halten sich nicht für kreativ, obwohl ihre Kreativität im Alltag oftmals gefragt ist und von ihnen auch – wohl eher unbemerkt - eingesetzt wird. Bei Eltern zum Beispiel. Sie sind im Alltag oftmals gefordert, ein Problem (das Kind liegt schreiend auf dem Boden eines Supermarktes, weil das Objekt seiner Begierde, z.B.: ein Schokoriegel, seitens der Mutter/des Vaters nicht genehmigt wurde) zeitnah originell zu lösen? Und entfaltet man nicht auch bei der Planung des Urlaubes, der Gestaltung der Wohnung/des Gartens oder innerhalb seines Berufslebens eine Kreativität? Diese Art Kreativität hält sich in Grenzen und ist sicher nicht mit der kreativen Entfaltung bei Künstlern zu vergleichen, aber es ist eine Kreativität. Als Kinder sind wir doch alle kreativ. Wir erdenken uns Phantasiewelten, in die wir abtauchen. In unserem Spiel gibt es Gegenstände, Wesen und Orte, die es in der realen Welt nicht gibt und wir suchen nicht immer nach logischen Lösungen innerhalb unserer kindlichen Problemwelt.
Und dann kommt die Schule, die sich dann für viele Jahre damit beschäftigt, unsere Kreativität dem logischen Denken zu opfern. Wir werden darauf hin trainiert, alle Aufgaben korrekt und logisch zu lösen. Wir werden auf die Leistungsgesellschaft vorbereitet, die im Großen und Ganzen weder Raum noch Zeit für Kreativität lässt und eben nicht darauf vorbereitet, in der Leistungsgesellschaft durch Kreativität zu existieren. Und dann sind da jene Personen, die sich weder durch die Schule noch durch Druck von außen von ihrer Kreativität abbringen lassen. Die von Kindesbeinen an ihre Kreativität anders nutzen und einsetzen. Die die Phantasiewelt mit der Welt dort draußen verbinden und diese Welt da draußen immer etwas bunter und schillernder durch ihre Ideen erscheinen lassen. Als Kind bin ich natürlich auch in die Phantasiewelten der anderen Kinder mit abgetaucht, aber ich fiel schon damals mit ungewöhnlichen Ideen auf. Zum Beispiel überredete ich im zarten Alter von neun Jahren meine Spielkameraden dazu, mit mir ein Hörspiel aufzunehmen, eine Fotostory zu gestalten und für eine Schulfeier einen Gruppentanz einzustudieren (während andere Klassen Kuchen und Salate verkauften), dessen Choreographie ich natürlich übernahm. Das war auch die Zeit, in der ich meine ersten Kurzgeschichten, Gedichte und Romane schrieb. Ständig inspirierte mich die Welt da draußen, alles war so aufregend. Für mich war es damals schon wichtig, erst einmal offen an alles heranzugehen. Und wenn ich im Alltag an etwas zu scheitern drohte, zog ich mich in meine Zwischenwelt zurück und versuchte, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Diese Vorgehensweise hilft mir noch heute und es hat mir keiner beigebracht oder vorgemacht, auf diese Art und Weise mit der Welt und den Menschen umzugehen. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, was ist eigentlich Kreativität, stieß ich dann unter anderem auf eine Liste: Merkmale kreativer Menschen und die dort aufgeführten Eigenschaften waren mir sehr vertraut: kulturelle Werte schätzen, Interesse an komplizierten Fragestellungen, Engagement und Leistungswille, Unabhängigkeit von Urteilen, Ausdauer, offen für neue Erfahrung, aus Denkmustern ausbrechen, gute Kommunikation, motivierend, Freiräume schaffen…
Es ist nicht immer einfach, seiner Kreativität zu folgen. Denn unsere Gesellschaft ist dafür einfach nicht ausgerichtet. Oft muss man sich zurücknehmen, sich anpassen und dabei aufpassen, dass man sich hier nicht verliert. Dass man nicht abstumpft, dass man weiter schwingt und hierfür braucht man Freiräume im Kopf und diese Freiräume ermöglichen es mir, kreativ zu sein.
Die Antwort, die ich gab, als ich gefragt wurde, woher ich meine Kreativität nehme, war im Nachhinein betrachtet doch gar nicht so platt, wie es mir erst erschien. Denn für mich ist Kreativität eine Frage der Inspiration von außen: die Augenblicke, die Momente, die Menschen, die Gerüche, die Musik, die Sonne, der Wind, der Regen, ein Buch, eine Umarmung, ein Lächeln, ein Gefühl des Glücks, der Trauer und der Enttäuschung…irgendetwas davon ist immer da, es begegnet mir überall.
Claudia Lekondra
Die Tagebücher meines Onkels & die Gedanken über unsere Rollen im Leben

Mein vor einigen Jahren im Alter von 86 Jahren verstorbener britischer Onkel hat Tagebuch über sein tägliches Leben geführt. Seit meiner Kindheit ein so vertrautes Bild: Mein Onkel mit einem Pelikanfüllfederhalter in der einen und manchmal mit einer Zigarre in der anderen Hand. Er nahm sich täglich die Zeit, eine Seite über seinen Tag zu füllen. Ich mochte es, meinem Onkel dabei zu sehen, wie er in Gedanken versunken dort saß und schrieb. Für mich wirkte er immer so zufrieden und ausgeglichen. Ich fragte mich in den all den Jahren, was er dort so schrieb, was ihn bewegte. Wenn ich ihn fragte, antwortete er immer, dass es sicher ganz langweilig für mich sei, aber dass ich eines Tages alles lesen und selber beurteilen könne. Zu seinen Lebzeiten vererbte er mir mit dieser Aussage seine Tagebücher. Wusste er doch, dass gerade seine kleine Nichte, die schon seit ihrer Kindheit Romane und Gedichte schrieb, vielleicht genau die richtige Person sein würde, die sich eines Tages seiner Tagebücher annehme.
Und dann lagen sie vor mir. Für jedes Jahr ein Buch seit 1972 bis zu seinem Tod. Und ich nehme mir die Zeit und lese regelmäßig in seinen Büchern. Wenn sich jetzt jemand fragt, ob mir je Bedenken oder Zweifel kamen, die Tagebücher meines Onkels zu lesen, muss ich es verneinen. Ich lese mit der Genehmigung meines Onkels und jeder, der ein Tagebuch führt, muss damit rechnen, beziehungsweise nimmt in Kauf, dass seine Eintragungen eines Tages von anderen gelesen werden. Ich sehe es eher als Vermächtnis eines Zeitzeugnisses an und als wahrlich wertvolles Erbe und gehe sorgsam mit seinen Gedanken, Gefühlen, Hoffnungen und Enttäuschungen, die ich seinen Eintragungen entnehme, um, indem ich sie zum größten Teil für mich behalte. Aber ich komme auch nicht umhin, diesen Eintragungen mit gemischten Gefühlen zu folgen. Da ist zum einen dieses unglaublich schöne Gefühl, dass er durch seine Tagebücher irgendwie noch da ist. Es fühlt sich alles so lebendig an und ich bekomme – wenn man die Eintragungen der Reihe nach liest- tatsächlich ein Gefühl für seinen Alltag, für das Leben, das er geführt hat, das sich doch sehr von dem Leben unterscheidet, was ich führe. Er ist mir dann so nah, so vertraut. Es ist so interessant von einem selber dort zu lesen, von gemeinsamen Urlauben, Feiern und anderen Unternehmungen, die man miteinander geteilt hat. Vieles ist einem eben vertraut, aber da ist auch dieses andere Gefühl, das mich bei manchen seiner Eintragungen überkommt, in denen er mir so fremd ist, dass ich nicht glauben will, dass das, was dort geschrieben steht, wirklich aus den Federn meines Onkels stammt. Dass dies wirklich seine Einstellung und Meinung war. Dieses Bild, was ich dort von ihm bekomme, passt so überhaupt nicht zu dem Menschen, den ich kannte. Das irritierte mich anfänglich und ließ mich darüber nachdenken, was es eigentlich ausmacht, dass wir uns ein Bild von einem Menschen machen. Ist es nicht so, dass wir nur das wahrnehmen können, was jeder bereit ist von sich preiszugeben? Ist es nicht so, dass man mit jedem Menschen in seinem Leben unterschiedlich umgeht, weil man ihm eben in unterschiedlichen Situationen begegnet? Es ist doch eigentlich klar, dass eine Mutter einen anders wahrnimmt als ein Onkel, dass ein Partner in einem etwas anderes sieht als die Kollegen. Dass man für jeden Freund, jeden Bekannten eine andere Rolle in dessen Leben einnimmt. Ein jeder Mensch hat so viele Facetten, die von den Mitmenschen unterschiedlich wahrgenommen werden, weil wir doch alle irgendwie unterschiedliche Rollen im Zusammensein mit unseren Mitmenschen einnehmen. Ich als Nichte habe ihn als Onkel wahrgenommen, nie als Vater, als Ehemann, als Freund oder Kollegen. Also sollte ich nicht in Frage stellen, ob ich ihn wirklich richtig gekannt habe, denn wen kennt man wirklich? Im besten Falle sich selber. Und wenn man über sich nachdenkt, wird man auch feststellen, dass doch die meisten Menschen um einen herum auch nur bestimmte Facetten von einem kennen. Und nach den anfänglichen Irritationen darüber, was ich dort zum Teil lese, habe ich für mich beschlossen, dass egal, was ich auf den weiteren Seiten der noch vor mir liegenden Tagebücher lesen und erfahren werde, er immer der bleibt, der er für mich zu Lebzeiten war. Ein toller liebevoller Onkel, mit dem ich so viele schöne amüsante Augenblicke verleben durfte und der dabei immer ausgeglichen, glücklich und zufrieden wirkte. Und so war es sicher auch. Denn wenn ich mit der Familie auf ihn traf, war er ausgeglichen, glücklich und zufrieden und deshalb habe ich ihn genauso wahrgenommen: Mit sich und der Welt im Einklang. RIP und thank you, dear uncle.
Claudia Lekondra
Stress passiert nicht

Jeder, der schon mal in Italien mit dem Auto unterwegs war, weiß, dass sich die Fahrweise dort erheblich von der in Deutschland unterscheidet. Das Abbiegen oder der Spurenwechsel wird selten durch den hierzu erfundenen Blinker angezeigt. Die Hupe wird eingesetzt, um den anderen Straßenverkehrsteilnehmern anzukündigen „Hoppla ich komme!“ und nicht, wie in Deutschland: “Hallo geht´s noch, Du verhältst Dich gerade nicht richtig im Straßenverkehr, Du behinderst mich“ (wobei hier die italienische Hupvariante die deutlich sympathischere ist). Die Vorfahrtsregelung wird selten eingehalten, dafür zeichnet sich die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer durch flexibles vorausschauendes Fahrverhalten aus, was einem ermöglicht, zu neunzig Prozent unbeschadet eine Kreuzung zu überqueren. Bei der Nutzung der jeweiligen Spuren sollte man nicht so kleinlich sein und darauf pochen, seine Spur nur für sich zu beanspruchen, sondern es ist vielmehr angesagt, sich bei Bedarf ganz rechts in seiner Spur einzuordnen, um dem Gegenverkehr oder den Überholenden die Möglichkeit zu geben, ihre Spur etwas auszuweiten. Kurz um, man darf keinesfalls ängstlich sein, sollte über eine überdurchschnittliche Fahrpraxis und ein gutes Augenmaß verfügen, dann steht der Teilnahme am italienischen Straßenverkehr erst einmal nichts im Wege. An dieser Stelle sei natürlich auch erwähnt, dass die Fahrweise sich auch von Region zu Region unterscheidet. Die größte Herausforderung ist hier –nach meiner bisherigen Erfahrung- Kampanien!
Eine Woche waren wir täglich mit dem Auto an der Amalfiküste und der umliegenden Region um Neapel unterwegs. Die besondere Herausforderung dort: Die Straßen sind eng und kurvig und man muss nicht selten eine Straßensteigung von 15% bewältigen und das alles bei hohem Verkehrsaufkommen. Der erste Blick auf den Zustand der Autos dort lässt darauf schließen, dass auch das Augenmaß der routinierten einheimischen Autofahrer der Realität oftmals unterliegt. Man sieht selten intakte Außenspiegel und beulen- und kratzfreie Autos. Als wir dann von Mitarbeitern der Automietstation drauf hingewiesen wurden, dass Beulen erst ab einer Tiefe von 5 cm als Schaden angesehen werden, schwante uns so langsam aber sicher, auf was für ein Abenteuer wir uns da einließen. Doch nach einer Viertelstunde Autofahrt vom Flughafen Richtung Amalfiküste hatten wir uns bereits mal wieder von den uns bekannten Verkehrsregeln verabschiedet und das heimische Fahrprinzip verstanden. Wie bereits erwähnt, man sollte nicht ängstlich oder zimperlich sein, nicht unnötig bremsen, sich trotz Stoppschild vorsichtig und gekonnt in den fließenden Verkehr einordnen, nicht auf sein Vorfahrtsrecht pochen, höflich andere statt dessen vorlassen und umgekehrt mal kurz und zackig klar machen, dass man jetzt auch gern mal fahren würde. Immer darauf gefasst sein, dass die Motorroller gefühlt von allen Seiten plötzlich und unerwartet (sie kommen nicht nur von rechts links vorn und hinten, sondern gefühlt auch von oben) auftauchen. Der Vorteil ist, dass sie meist durch fröhliches Hupen auf sich aufmerksam machen, wenn sie vermuten, dass sie von einem anderen Verkehrsteilnehmer nicht wahrgenommen werden. Durch diese flüssige zügige Fahrweise kommt es selten zum Stau, sondern der Verkehr fließt, wenn auch zur Rushhour zähflüssig. Ein Stau entsteht, wenn ein Reise- oder Verkehrsbus sich an bestimmten Stellen die kurvenreiche Küsten- oder Dorfstraße entlang tastet. Man muss hier oftmals minutenlang ausharren, selber sein Fahrzeug ganz rechts an den Fahrbahnrand quetschen, alles einklappen, was sich an einem Fahrzeug einklappen lässt und warten, bis es dem Busfahrer gelingt, durch Vor-und Rückrangieren sein Ungetüm um die Kurve zu lenken. Bei all diesen Aktionen entsteht weder Unruhe, Hektik noch Stress. Alle Verkehrsteilnehmer strahlen eine Gelassenheit aus und zeichnen sich durch geschicktes Lenken ihrer Fahrzeuge aus. Diese Beobachtung ließ mich über uns und unser hektisches und oft gestresstes Verhalten nachdenken. Auch dort müssen die Leute zur Arbeit und Termine einhalten, aber lassen sich –für unsere Verhältnisse- auch in stressigen Verkehrssituationen nicht aus der Ruhe bringen. Und während ich dort so mitten drin das Treiben auf den Straßen beobachtete, kam mir der Spruch: Stress passiert nicht. Stress ist die Art, wie Du auf Dinge reagierst, in den Sinn und ich fühlte mich mitten in dem hupenden sympathischen Straßenchaos sonderbar entspannt. Vielleicht gelingt es mir ja, wenn ich beim nächsten Mal wieder Gefahr laufe, auf Dinge gestresst zu reagieren, mich an die kurvenreiche Straße Kampaniens und deren stressfreien Verkehrsteilnehmern zu erinnern, die offenbar die richtige Art haben, auf Dinge zu reagieren.
Claudia Lekondra
Wo endet eine offene Gesellschaft

Eine Predigt anlässlich einer Taufe hat mich dazu verleitet, mich zu fragen, ob unsere offene Gesellschaftsform in Deutschland in Gefahr ist. In der Predigt wurde von Abschottung des Einzelnen in unserer Gesellschaft gesprochen, von dem fehlenden Miteinander. Dass eine Gesellschaft beispielsweise nicht offen sei, wenn man nicht einmal den Namen seiner Nachbarn kenne. Ich glaube, dass uns in Deutschland die größtmögliche individuelle Freiheit bei größtmöglicher Sicherheit geboten wird. Wir leben in einer Zeit, in der viel über Haltung und Werte diskutiert wird. Durch die Digitalisierung erreichen uns immer mehr Informationen immer schneller und für jeden einzelnen von uns stellt sich dann die Frage, wie wir mit der Flut der Informationen umgehen, wie wir sie einzuordnen haben. Eine offene Gesellschaft transportiert täglich neue Impulse, die Veränderungen in unserem täglichen Leben mit sich bringen. Das Leben wird nicht unbedingt besser, weil einen alles schneller erreicht und sich alles um einen herum verändert und man sich ständig den Veränderungen versucht anzupassen. Nein, es verunsichert viele Menschen, es wirft Fragen auf, auf die es nicht immer Antworten zu geben scheint. Viele Menschen fühlen sich einfach nur überfordert und sie sehnen sich einen überschaubaren Lebensraum zurück, in dem es ihnen leichter fiel, einem Wertesystem zu folgen.
Ist unsere offene Gesellschaft in Gefahr, weil die Menschen aus Verunsicherungen sich mehr und mehr zurückziehen? Weil sie versuchen sich abzuschotten, indem sie
ihrem unmittelbaren Umfeld, zum Beispiel ihren Nachbarn, den Kollegen und den Bekannten, nur noch oberflächig begegnen und sich mehr und mehr auf sich und ihre Sorgen und Ängste konzentrieren und
nicht einmal mehr die Namen der Nachbarn kennen? Indem sie nur noch wahrnehmen, was sie unmittelbar betrifft und alles was über den Tellerrand hinausgeht wird ignoriert? Man versucht seine Welt
wieder überschaubar zu machen, indem man es vermeidet, neue Einflüsse von außen zuzulassen und sperrt damit sein Umfeld aus? Laufen wir Gefahr, so aus unserer offenen Gesellschaft eine
geschlossene Gesellschaft zu machen? Ich weiß nicht, ob die Pfarrerin in ihrer Predigt mit Ihrer These recht hat, dass der Anfang einer geschlossenen Gesellschaft darin zu finden ist, dass man
den Namen seines Nachbarn nicht kennt, ich weiß nur, dass ich nicht so naiv bin, und mir bewusst ist, dass eine offene Gesellschaft auch Gefahren, Ängste und Nöte mit sich bringt und dass es
immer Menschen geben wird, die mit den Ängsten der anderen versuchen werden ihre Art der Weltanschauungen, die überschaubare und eben nicht offene Sichtweise, zu vermitteln. Ich weiß auch nicht,
wo genau eine offene Gesellschaft endet (ob wirklich beim Namen des Nachbarn), ich weiß nur, dass ich in einer offenen Gesellschaft leben möchte. An dieser Stelle möchte ich gern einen Satz
zitieren, den ich letztens gelesen habe: Wer sich in einem dunklen Raum einschließt, der ist zwar vor Regen und Wind geschützt, aber zugleich abgeschieden von Luft und Licht. Ohne Luft und Licht
möchte ich nicht leben und Regen und Wind, finde ich eigentlich nicht so schlimm.
Claudia Lekondra
Das Leben beginnt am Ende Deiner Komfortzone, wirklich?

Jeder von uns kennt sie, die Komfortzone. Dieses Gefühl der vermeintlichen Sicherheit, indem wir es vermeiden Neues zu wagen, Dinge in unser Leben zu lassen oder Dinge zu verändern, bei denen wir nicht wirklich einschätzen können, wie sie sich auf unser Leben auswirken. Dinge, die außerhalb unserer Komfortzone liegen, machen uns oftmals Angst, daher vermeiden wir sie. Neue Situationen bedeuten unweigerlich Veränderungen. Und da sind unsere Bequemlichkeit, Angst und Zweifel, die uns eben davon abhalten, sie zu verlassen. Aber da ist auch oftmals der Wunsch, Herausforderungen annehmen zu wollen, der Wunsch an ihnen zu wachsen und die Persönlichkeit zu entwickeln. Da stellt sich die Frage: ist es wirklich nur möglich, seine Persönlichkeit zu entwickeln, indem man die Komfortzone verlässt? Da gibt es Menschen, die ständig außerhalb ihrer Komfortzone leben. Sie lieben das Abenteuer, den Nervenkitzel und können einfach nicht verweilen. Wann hat bei denen die Veränderung der Persönlichkeit einst angefangen, dass sie ständig das Bedürfnis haben, ihre Komfortzone zu verlassen?
Ich weigere mich dem Aufruf zu folgen, dass das Verlassen der Komfortzone die einzige Möglichkeit sei, aus einem mittelmäßigen Leben ein besonderes zu machen. Ist nicht auch eine Entwicklung innerhalb der Komfortzone möglich? Eine Zeit lang lebt man zufrieden und glücklich in seiner Komfortzone und dann ist er auf einmal da, der Wunsch nach Veränderungen. Oftmals ist einem nicht gleich klar, in welche Richtung man die Komfortzone verlassen möchte. Da sind doch eigentlich die Gewohnheiten, die Rituale und die Routine, die uns doch so wichtig sind und dennoch ist da dieses Bedürfnis nach Veränderung. Die Frage ist: Wie entsteht dieser Wunsch, wenn es doch angeblich nicht möglich sein soll, sich innerhalb seiner Komfortzone zu verändern? Ist es nicht eher so, dass man sich fast unbemerkt Schritt für Schritt aus seiner Komfortzone bewegt, weil man auf einmal Ziele hat, die außerhalb liegen? Ist es nicht ein klares Indiz dafür, dass man sich weiter entwickelt und verändert hat und somit also ein Leben innerhalb der Komfortzone sehr wohl stattfindet? Die Zeit muss einfach reif sein und bis dahin sind es die kleinen Dinge in unserem Alltag, von denen wir lernen, an denen wir wachsen. Wichtig ist, dass wir uns keinen Druck machen, dass wir uns nicht eben von denen verunsichern lassen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit ständig ihre Komfortzone verlassen, sondern wir dazu stehen, wenn wir uns gerade wohl fühlen, so wie wir leben. Eben mit der Bequemlichkeit, den Gewohnheiten und Ritualen. Solange wir sie als Wohlfühlzone empfinden, ist doch alles gut wie es ist. Wir müssen einfach nur aufmerksam mit uns umgehen, damit wir den Moment nicht verpassen, wenn die Zeit reif ist, unsere Komfortzone zu verlassen.
Sie nicht zu verlassen, wenn die Zeit reif ist, könnte ansonsten vielleicht tatsächlich bedeuten, dass das Leben erst am Ende Deiner Komfortzone beginnt.
Claudia Lekondra
Dankbarkeit, das Gegenmittel für negative Gefühle

Schon einmal über die Dankbarkeit nachgedacht? Unabhängig davon, was und wem wir dankbar sind, sei es einem anderen Menschen oder dem Schicksal an sich, ist die Wirkung positiv. Dankbarkeit ist
ein Gegenmittel für negative Gefühle wie Ärger, Neid, Groll und Sorge.
Ich habe letztens eine Studie zum Thema Dankbarkeit gelesen. Darin heißt es, dass dankbare Menschen glücklicher, optimistischer, hilfsbereiter und einfühlsamer sind. Natürlich stellt sich die
Frage, ob Dankbarkeit dabei die Ursache ist oder einfach eine weitere Wirkung? In einem wissenschaftlichen Experiment wurden Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt. Einige Wochen lang sollte die
eine Gruppe jeden Abend fünf Dinge aufschreiben, für die sie dankbar waren. Die andere Gruppe sollte jeden Abend fünf Dinge notieren, über die sie sich geärgert hatten. Ihr ahnt das Ergebnis
sicher schon: Die Teilnehmer der ersten Gruppe, also die, die jeden Abend sich über die Dankbarkeit Gedanken machten, waren optimistischer und zufriedener mit sich und ihrem Leben. Sie nahmen
sich als gesünder wahr und trieben mehr Sport. Das Experiment ergab also, dass das Gefühl der Dankbarkeit also wesentlich zum Wohlbefinden und zur Gesundheit beiträgt. Wer also dankbar ist, kann
positive Erfahrungen mehr genießen und erlebt weniger negative Gefühle.
Bevor man sich mal wieder über alltägliche Dinge ärgert und sich Gedanken darüber macht, was alles Negatives auf dieser Welt geschieht und noch geschehen könnte, sollte man die Idee des
Experiments übernehmen und sich abends immer fünf Dinge notieren, für die man an diesem Tag dankbar war oder sich einfach generell mal hinsetzen und aufschreiben, worüber man grundsätzlich
dankbar ist, so jeden Tag aufs Neue… also sozusagen die Dankbarkeit als Schlüssel zum persönlichen Glück leben.
Claudia Lekondra
Der Moment, in dem eine Geschichte entsteht…

Nachdem ich entspannt in das neue Jahr gestartet bin, habe ich die ersten Wochen des Jahres damit verbracht, mich zu entscheiden, welche der zwei Geschichten, die so in meinem Kopf herumschwirrten, nun mein neuer Roman werden soll. Da bestünde natürlich die Möglichkeit, zwei Romane gleichzeitig zu schreiben. Es soll Kollegen geben, die beherrschen diese Vorgehensweise perfekt. Da muss ich passen. Kann ich nicht. Ich muss mich auf eine Geschichte und deren Figuren konzentrieren. In dieser Hinsicht bin ich sogar nicht multitaskingfähig. Am Anfang steht immer ein Thema, über das ich schreiben möchte und zu diesem Thema gehört immer etwas, was ich vermitteln möchte: Ein Gefühl, eine Sichtweise. Ich tauche ab in die Geschichte, entwickle die Figuren in meinem Roman und deren Charaktere. Sie werden mir nach und nach vertraut. Während ich mich mit ihren Gedanken, Gefühlen, Entscheidungen und Beobachtungen auseinandersetze, bin ich oft erstaunt, wohin mich die Geschichten führen und das gelingt mir nur, wenn ich mich auf eine Geschichte konzentriere. Ich bin mitunter selber überrascht, welche Wendungen meine Sichtweisen mitunter nehmen, wenn ich meine Figuren zum Leben erwecke und mal schaue, wie sie auf was reagieren und genau das macht für mich das Schreiben so spannend, ich kann vorübergehend jemand anders sein. Es ist mir auch schon passiert (so war es zum Beispiel bei „Weder Himmel noch Hölle“), dass sich die Geschichte in eine ganz andere Richtung entwickelte, so dass aus einem angedachten humorvollen Roman, der den Alltag eines Anwaltsbüros wiedergeben sollte, doch weitaus mehr wurde. Das Anwaltsbüro war irgendwann nur noch der Schauplatz, und es wurde eine ganz andere Geschichte erzählt, als ich zunächst wollte.
Nach Vollendung dieses vierten Romans hatte ich mir eine Schaffenspause gegönnt. Dann verspürte ich den Wunsch, mein erstes Werk „Und nichts die Stunde uns wiederbringen kann“ zu überarbeiten und mit diesem Projekt hatte ich mich dann bis letztes Jahr beschäftigt. Und nun war also der Moment gekommen, mich vor den Computer zu setzen und meinen fünften Roman zu beginnen. Der Cursor blinkte fröhlich auf dem Bildschirm und ich dachte: So, nun werden deine Finger dir doch den Weg weisen und los schreiben und dir zeigen, welche Geschichte es denn nun wird. Taten sie aber nicht. Ich beobachtete den blinkenden Cursor und meine Finger taten nichts. Die blockierten und ich fragte mich, ob das mit der Schaffenspause (bezogen auf den fünften Roman, es war ja nicht so, dass ich in der „ Pause“ nicht nichts geschrieben habe) doch keine so gute Idee gewesen war. Aber hatte ich mir nicht immer vorgenommen, mich von meinem Gefühl, von meiner Eingebung leiten zu lassen? Und die sagte damals nach dem vierten Roman ganz klar: Pause! Vielleicht war das falsch. Vielleicht unterbricht man damit seinen Schreibfluss. So blinkte der Cursor weiter und meine Hände taten nichts. Und dann stand ich letzten Freitag in der Küche und bereitete für Freunde ein Vier-Gänge-Menü vor. Während meine Hände in den Kochtöpfen rührten und im Hintergrund Musik spielte, formte sich in meinem Kopf der Anfang einer Geschichte und auf einmal war mir klar, das ist sie! Ja, ich weiß, ein denkbar ungünstiger Augenblick, mang den Kochtöpfen und unter leichtem Zeitdruck. Bei allem Verständnis, das meine Gäste sicher für Kreativität grundsätzlich aufbringen, hätte das Verständnis genau dann ein jähes Ende gefunden, wenn ich den ersten und zweiten Gang durch mehrere Aperitifs ersetzt hätte. So blieb mir nur ein Notizblock, der auf der Arbeitsplatte zwischen Herd und Spüle platziert wurde und ich hielt nebenher stichpunktartig meine Gedankenansätze fest. In dieser Sache bewies ich dann doch die Fähigkeit zum Multitasking, denn das vier Gänge Menu war pünktlich fertig, und ich empfing meine Gäste entspannt und von meinen Gedankenergüssen beseelt, bestens gelaunt und stellte fest, dass mir das Kochen zuvor noch nie so einen Spaß gemacht hatte, wie an diesem Tag.
Einen Tag später setzte ich mich an den Computer und schrieb los und der Cursor kam gar nicht mehr zum Blinken. Und nun lasse ich mich treiben, von der Idee und bin schon ganz gespannt, wem ich alles in meiner neuen Geschichte so begegne und wie sie wohl enden wird. Ob ich nach circa 200 Seiten (mehr habe ich mir für dieses Mal nicht vorgenommen, das überarbeitete Werk umfasst über 600 !!!!! Seiten) wieder erstaunt feststelle, dass alles so ganz anders kam? An dieser Stelle möchte ich gern Roland Barthes zitieren: Das Schreiben, als Prozess verstehen, in dem sich der Schreibende auflöst, Teil des Textes wird. Genau so fühlt es sich für mich an.
Claudia Lekondra
Die Sache mit den guten Vorsätzen…

Das war es also, das Jahr 2016. Wieder hat man ein Jahr hinter sich gelassen und schaut mit freudiger Erwartung und der eine oder andere sicherlich auch mit Skepsis auf das bevorstehende Jahr 2017. War man gerade noch in vorweihnachtlicher Stimmung mit dem Besorgen von Geschenken und mit Weihnachtsfeiern beschäftigt, fand man sich schon mit Freunden und Familie unter dem Weihnachtsbaum ein, um dann noch die letzten Planungen, Vorbereitungen und Entscheidungen bezüglich der bevorstehenden Silvesternacht (wie feiert man, mit wem und wo und ob überhaupt?) zu treffen, um dann am Morgen des 1. Januars –der eine oder andere hier leicht verkatert – dem neuen Jahr entgegen zu blinzeln, noch nicht wirklich bereit, sich im Hier und Jetzt einzufinden.
Da kommt dann wieder die Feststellung, das Jahr sei ja mal wieder so schnell vergangen (was nicht stimmt, siehe hierzu meinen Blog vom Januar letzten Jahres: wir haben nur drei Sekunden für die Gegenwart) und da wären ja auch noch die guten Vorsätze für das neue Jahr! Hier handelt es sich meist um Themen wie: ich höre auf zu rauchen, ich tue mehr für meine Gesundheit, bewege mich mehr und ernähre mich gesünder, ich arbeite weniger und nehme mir mehr Zeit für Freunde und Familie. Mit Gedanken wie: Ich bin unglücklich im Job, in der Beziehung und/oder mit den darüber hinausgehenden Lebensumständen befasst man sich hingegen in diesem Zusammenhang selten, erscheinen diese Themen doch von vornherein zu komplex, und man will ja schließlich nicht gleich am 1. Januar für eine depressive Stimmungslage sorgen. Da scheinen doch die anderen Vorsätze, eben das Rauchen aufzugeben, sich mehr zu bewegen etc. umsetzbar… und schon flüstert der Schweinehund in uns süffisant: Den Vorsätzen, den guten alten, denen bleiben wir stets treu, wir wollen sie gerne behalten, sie sind ja noch wie neu! Und wir müssen uns eingestehen, dass der Schweinehund so recht hat.
Die Vorsätze für dieses Jahr ähneln den Vorsätzen vom letzten Jahr verdächtig. Woran liegt es, dass man mit seinen Vorsätzen meist so kläglich scheitert? Liegt es daran, dass die Vorsätze nicht wirklich mit uns etwas zu tun haben? Liegt es daran, dass ein Vorsatz kein Ziel, sondern ein Vorhaben ist? Also frei nach Goethe: Es nicht genug zu wollen, man muss auch tun? Wir wollen eben nicht aufhören zu rauchen, weil wir uns doch gerade mit der Zigarette in der Hand so wohl und entspannt fühlen. Mehr Bewegung, eigentlich konnten wir uns noch nie für sportliche Betätigungen begeistern und lieben unsere Bequemlichkeit. Mehr Zeit für Familie und Freunde würde bedeuten, die Zeitressourcen neu zu überdenken, um diese Dinge im Alltag anders unterzubringen. Aber fühlen wir uns nicht eigentlich so ganz wohl, wie es gerade ist? Vielleicht verfügen wir ja weder über genug Selbstdisziplin noch über Ausdauer für diese Vorsätze, noch wollen wir vielleicht deren Notwendigkeit erkennen (es reicht doch, wenn ich einen Tag am Wochenende mit der Familie verbringe und die Freunde dreimal im Jahr sehe). Ich für meinen Teil bin froh, dass ich zu der Spezies unter uns gehöre, die noch nie mit den sogenannten Vorsätzen in ein neues Jahr gestartet sind. Frei nach dem Motto, ich habe den Vorsatz keine Vorsätze für ein neues Jahr zu fassen, sondern starte entspannt und neugierig in das neue Jahr. Um es mit Henry Fords Worten auszudrücken: Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst: In diesem Sinne: Happy 2017!
Claudia Lekondra
Weniger müssen, dafür ganz viel wollen

Ist Euch eigentlich schon mal aufgefallen, wie oft wir das Wort „muss“ in unserem alltäglichen Sprachgebrauch einsetzen? Und wie oft das „Muss“ kein wirkliches „Müssen“ ist? Damit es einem auffällt, setzt es erst einmal voraus, dass wir uns selber und den anderen wirklich zuhören und eben nicht über solche Art Formulierung hinweg sprechen beziehungsweise hinweg hören.
Als ich mir so zuhörte, war ich entsetzt, wie oft ich das Wort einsetzte und somit oftmals aus einem „Wollen, Dürfen, Möchte“ ein „Müssen“ beziehungsweise aus einem Plan oder Idee ein „Muss" wurde.: „Ich muss mal sehen, ob ich noch vorbei kommen kann. (nein, ich werde mal sehen ob und nicht ich muss). Aber ebenso erschreckend war, wie oft man dieses „Muss“, als Füllwort benutzt, so, als stehe die Satzaussage anderenfalls nicht:
„Ich muss mein Kind von der Schule abholen", nein: "Ich hole mein Kind von der Schule ab.“ Sicher gibt es Dinge, die man muss: essen, trinken, atmen, sterben… aber ansonsten? Was müssen wir schon?
Ich muss, klingt immer nach Druck, nach Stress, nach Jammern. Und selbst wenn es sich um Dinge handelt, die man persönlich als „Muss" empfindet, fühlen sich diese – meist selbst auferlegten – Verpflichtungen ohne „muss“ nicht ganz so schlimm an. Durch die Vermeidung des Wortes „muss“ nimmt man sich den Druck und wenn man sich den Druck nimmt, fühlt man sich freier und wenn man sich freier fühlt, holt man sich die Lebensqualität zurück.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine entspannte Adventszeit, mit weniger „Müssen“ und ganz viel „Wollen, Möchten, Dürfen“.
Claudia Lekondra
Wenn jemand eine Reise tut...

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Bei diesem Satz denkt man unmittelbar an eine Reise in andere Länder, andere Kontinente oder hat wenigstens vor Augen, dass die heimatliche Umgebung verlassen wird. Glaubte ich auch, bis zu jenem Samstag im Oktober, als ich mit Freunden beschloss, unsere leuchtende Heimatstadt Berlin zum Festival oft Lights zu bewundern. Mutig erklärte ich meinen Begleitern, dass man an diesem Abend doch die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt nutzen sollte. Mein Vorschlag stieß bei den eingefleischten Autofahrern nicht auf sonderliche Begeisterung, aber immerhin gelang es mir, sie mit gutem Zureden davon zu überzeugen, nicht auch zu dem Personenkreis zu gehören, der durch die Nutzung des eigenen Pkws die Innenstadt verstopft.
Bei mehr oder weniger milden Temperaturen, bestens gelaunt und in freudiger Erwartung auf die leuchtende Stadt, versuchten wir nun vom Savignyplatz aus zum Alexanderplatz zu gelangen. Eine Strecke mit der S-Bahn, die unter normalen Umständen fünfzehn Minuten ausmacht. Unser Vorhaben scheiterte zunächst am Schienenersatzverkehr zwischen dem S-Bahnhof Charlottenburg und dem S-Bahnhof Friedrichstraße. Am Bahnsteig wies ein Schild mit einem Pfeil (der einen nicht wirklich Aufschluss darüber gab, wohin man sich nun genau zu bewegen hatte) darauf hin, wo man die Haltestelle des Schienenversatzverkehrs finden würde. Gott sei Dank waren wir hier nicht völlig ortsunkundig, so dass wir mit dem Hinweis, die Haltestelle des Schienenersatzverkehrs befinde sich dort, wo sich die Haltestelle des M45 befand, etwas anfangen konnten. Immer noch motiviert und gut gelaunt erreichten wir die Ersatzhaltestelle und stießen dort auf eine Menschentraube, die uns die Überlegung anstellen ließ, ob man überhaupt mit dem nächsten Bus mitkommen würde.
Die Nähe des Bahnhofs Zoo verleitete uns dazu, davon auszugehen, dass man die dort verkehrenden Busse der Linien 200 und 100, die die City West mit der City Ost verbinden, doch sicher im Hinblick auf das Event und dem Umstand, dass ein Schienenersatzverkehr auch für den Bahnhof Zoo galt, in kürzeren Abständen einsetzte und man durch die Möglichkeit, beide Busse nutzen zu können, schneller an sein Ziel gelangen würde. Diese Überlegung kann man gut und gerne als fatale Fehleinschätzung unsererseits bezeichnen. Wir erreichten den Bahnhof Zoo nach einem Fußweg von ungefähr zehn Minuten, um dann dort festzustellen, dass der Umfang der dortigen Menschentraube die vom Savignyplatz locker in den Schatten stellte. Die elektronische Anzeigetafel zu den jeweiligen Buslinien wies darauf hin, dass aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in der Innenstadt der Busverkehr auf diesen Linien unregelmäßig sei.
Leicht frustriert, aber dennoch immer gut gelaunt, entschieden wir uns nun, es doch mit dem Schienenersatzverkehr zu versuchen. Leichter gesagt, als getan. Wir liefen die Haltestellen am Bahnhof Zoo ab und entdeckten dort auch eine Haltestelle des Schienenersatzverkehrs, mussten jedoch bei näheren Begutachtung des Fahrplanes (man hatte hier darauf verzichtet, klar von weitem sichtbar zu kennzeichnen, um welchen Schienenersatzverkehrs es sich handelte und in welche Richtung dieser von dort aus bedient wurde) feststellen, dass es offensichtlich mehrere Strecken in der Stadt gab, die von einem Schienenersatzverkehr betroffen waren.
Nachdem wir ergebnislos zwischen den Haltestellen nach unserer Abfahrtstelle für den Schienenersatzverkehr Richtung Friedrichstraße suchten und auch keine sonstigen Schilder uns den Weg wiesen, liefen wir in unserer langsam aufkommenden Verzweiflung (zu diesem Zeitpunkt waren wir bereits fünfundvierzig Minuten nur damit beschäftigt loszufahren) zum Bahnsteig Bahnhof Zoo und fanden dort tatsächlich einen Hinweis (allerdings ähnlich wie am S-Bahnhof Savignyplatz war auch hier die Auskunft sehr vage, und auch in diesem Fall nur halbwegs Ortskundigen eine Hilfe).
Wir postierten uns dann –zwar leicht frustriert, die ersten schlugen auch bereits vor, das Vorhaben abzubrechen, und es sich statt dessen in einer Bar mit einem Drink bequem zu machen – an der Ersatzhaltestelle und schafften es auch, uns mit den anderen Fahrgästen in den völlig überfüllten Bus zu quetschen. Einer von uns hielt tapfer die erworbene Fahrkarte in der Hand und suchte nun im Bus nach der Möglichkeit, diese zu entwerten. Vergeblich. Auf Nachfrage beim nicht unfreundlichen, aber auch nicht sonderlich freundlichen (halt irgendetwas dazwischen) Busfahrer erhielt man die Auskunft:“Gibt’s nicht. Stecken Sie das Ding weg.“ Und schon ging es los- endlich - Richtung Friedrichstraße. Die Fahrt an sich verlief zügig und kaum, dass der Bus an der Endstation des Schienenerzsatzverkehrs an der Friedrichstaße stoppte, wurde bereits die Innenbeleuchtung ausgeschaltet, so dass wir alle versuchten, beim Verlassen des dunklen Innenraumes im Bus möglichst nicht zu verunfallen. Von dort legten wir den Rest des Weges zum Alexanderplatz zu Fuß zurück.
Mit einer Verspätung von 1 ½ Stunden starteten wir dann mit dem Festival of Lights, zwar in einer verkürzten Fassung, da uns bereits kostbare Zeit verloren gegangen war, aber immer noch bestens gelaunt, weil solche Kleinigkeiten wie, man benötigt statt fünfzehn Minuten über eine Stunde, um an das begehrte Ziel zu gelangen, uns nicht wirklich nachhaltig verstimmen konnten.
Aber wie sollte es anders sein: Auf den öffentlichen Nahverkehr war natürlich Verlass, die Gunst der Stunde zu nutzen und den eingefleischten Autofahrern dieser Stadt klar vor Augen zu führen, warum sie nie auf Ihr Auto verzichten würden.
Vom Potsdamer Platz starteten wir zwei Stunden später unseren Rückweg. Hier standen uns insgesamt drei Busse für die Rückfahrt zur Verfügung. Also theoretisch. In der Praxis natürlich nicht. Zunächst gab die elektronische Anzeigetafel wieder darüber Auskunft, dass der Busverkehr im Hinblick auf das hohe Verkehrsaufkommen unregelmäßig sei, wobei diese Auskunft sehr wohlwollend formuliert war. Zwanzig Minuten tauchte kein Bus auf. Lediglich die Anzeigentafel blinkte von Zeit zu Zeit fröhlich vor sich hin und kündigte an, dass jetzt einer der begehrten Busse eintreffen würde, um dann vom Aufblinken wieder auf: Der nächste Bus kommt in zehn Minuten umzuschalten, ohne, dass wir einen Bus zu Gesicht bekamen.
Als dann endlich der erste Bus auftauchte, war dieser derartig überfüllt, dass er keine Fahrgäste an der Station mehr aufnahm. Der nächste nahm Fahrgäste auf, aber nicht uns. Vor unserer Nase wurde die Tür wegen Überfüllung geschlossen. Beim dritten Bus, der zwar einen Umweg für uns bedeutete, hatten wir Glück und schafften es, uns in den völlig überfüllten Bus zu quetschen. Es war schon ein tolles Gefühl, dass man nun zu den Privilegierten gehörte, die einen Stehplatz im völlig überfüllten Bus ergattern konnten, während man an den vielen Haltestellen vorbeifuhr, an denen andere Fahrgäste sehnsüchtig den nicht haltenden völlig überfüllten Bus hinterher schauten und nun auf einen anderen hoffen mussten.
An der nächsten Umsteigemöglichkeit verließen wir den Bus und konnten unsere Freude kaum verbergen, als die Anzeigetafel dort das Eintreffen unseres Busses ankündigte, der nun unsere Fahrt Nachhause fortsetzen sollte. Ja, ich sehe schon, wie ihr jetzt alle ein sehr müdes Lächeln für uns übrig habt und Euch denkt, bei alle dem, was sie an diesem Abend erlebten, waren die wirklich so naiv und glaubten, dass auch ein Bus käme, wenn es blinkt? Ja, ich stehe dazu, waren wir. Immerhin hatten wir den Innenstadtbereich verlassen und man durfte doch nun davon ausgehen, dass nicht sämtliche Busse in Berlin an diesem Abend ihren Fahrplan nicht einhielten. Es kam natürlich kein Bus, als es blinkte und wir standen in einer nicht gerade schönen und eher unsicheren Gegend unserer Stadt eine halbe Stunde auf der Straße und warteten. Allerdings wurden wir mit Polizeieinsätzen inklusiver intensiven Fahrzeugkontrollen (deren Insassen schossen dann noch Selfies von sich und dem Polizeieinsatz im Hintergrund) bestens unterhalten.
Als dann der Bus endlich kam, schaffte er es nicht, an unserer weiteren Anschlusshaltestelle rechtzeitig einzutreffen, damit wir den letzten Bus erreichen konnten. Aber wir wollten immer noch nicht die Stimmung kippen lassen, obwohl wir zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Stunden damit beschäftigt waren, Nachhause zu gelangen und steuerten auf den nahe gelegenen Taxistand zu, um, ist schon klar oder? Ja, richtig: Festzustellen, dass dort keine einzige Taxe stand. Zwei der dann eintreffenden Taxen wurden uns direkt vor der Nase weggeschnappt, obwohl kaum Passanten auf der Straße waren (aber die, die unterwegs waren wollten halt Taxe fahren). Nach einer gefühlten Ewigkeit, ich habe mich im Geiste bereits Nachhause laufen sehen, kam eine weitere Taxe, die wir uns nicht wegschnappen ließen…
Nun sagt mal nicht, man hat nichts zu erzählen, wenn man sich entscheidet, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Meine Begleiter an diesem Abend sind sich jedoch einig, dass sie auf diese
Art Reisen verzichten können und lieber wenn, richtig verreisen (in 2 ½ Stunden schafft man es ja zum Beispiel immerhin nach Spanien oder Italien–allerdings mit dem Flugzeug). Ich muss an dieser
Stelle auch nicht erwähnen, dass sie freiwillig nicht mehr auf ihr Auto verzichten werden und die öffentlichen Verkehrsmittel stattdessen meiden.
Also denkt immer an die Geschichte, wenn ihr alle mal wieder im Stau steht, weil gefühlt, die ganze Stadt im Auto unterwegs ist…denn genau so ist es.
Claudia Lekondra
Urlaub, die schönsten Tage im Jahr!

Ihre schönsten Tage im Jahr, damit werben Reiseveranstalter sowie Reiseportale im Netz und schüren mit dieser Aussage eine Erwartungshaltung, die dem einen oder anderen sicher schon die eine oder andere Enttäuschung beschert hat. Kein Wunder; die schönsten Tage im Jahr!? Mit dieser Aussage lehnt man sich schon weit aus dem Fenster, wie man so schön zu sagen pflegt.
Sicher, optimal, wenn die Tage des Urlaubes mit zu den schönsten Tagen im Jahr gehören, aber erwarte ich oder will ich, dass es die Schönsten des Jahres sind?
Das Jahr besteht in der Regel aus 365 Tagen, sprich aus 52 Wochen. In unserem Land machen die Leute durchschnittlich sechs Wochen Urlaub im Jahr. Gehen wir von 52 Wochen im Jahr aus, würde das bedeuten, dass 46 Wochen und somit 322 Tage keine Chance haben, die schönsten Tage im Jahr zu werden?!
Also ich gebe allen Tagen des Jahres die Chance, einer der Schönsten des Jahres zu werden. Da habe ich nun meinerseits eine gewisse Erwartungshaltung. Die Erwartung, dass sich die schönsten Tage des Jahres über das Jahr verteilen und auch im besten Falle mehr als sechs Wochen ausmachen. Würde es doch auch im Umkehrschluss bedeuten, dass die Leute, die keinen Urlaub machen und ein Jahr durcharbeiten (ob nun freiwillig oder gezwungenermaßen), gar nicht erst die Chance haben, die schönsten Tage zu erleben?
Und wie verhält es sich damit, dass Urlaub einen manchmal vor unerwartete Herausforderungen stellt und somit von den schönsten Tagen des Jahres nicht mehr die Rede ist, sondern vielmehr davon, wie übersteht man den Urlaub? Wenn man auf einmal feststellt, dass, wenn man täglich 24 Stunden miteinander verbringt, sich nicht mehr wirklich etwas zu sagen hat? Wenn man im Urlaub erfahren muss, dass man sich auseinander gelebt hat und der andere einem fremd geworden ist. Entwicklungen der Kinder im Alltag an einem vorbei gerauscht sind und sie einem teilweise merkwürdig entrückt erscheinen?
Aber natürlich geht es auch anders. Man ist 24 Stunden glücklich, seine Lieben nun ständig um sich zu wissen und wünschte, dass es immer so weiter ginge (naja immer ist dann jetzt doch etwas dick aufgetragen. Sagen wir, halt in den Wochen des Urlaubes.)
Wenn man zum einen seine Erwartungshaltung zurückschraubt, sich zum anderen mit dem Gedanken anfreundet, dass so ein Urlaub auch eine wahre Herausforderung für das Miteinander werden kann und man auch - wenn es im Urlaub nicht alles so perfekt läuft - gewillt ist, das Beste aus dem Urlaub zu machen, hat man gute Chancen, dass es jedenfalls nicht die schlimmsten Tage des Jahres werden.
In diesem Sinne, all denen, die ihn noch vor sich haben: Einen gelungenen Urlaub!
Claudia Lekondra
Ein schöner Moment, ein kleines Mädchen und eine S-Bahnfahrt...
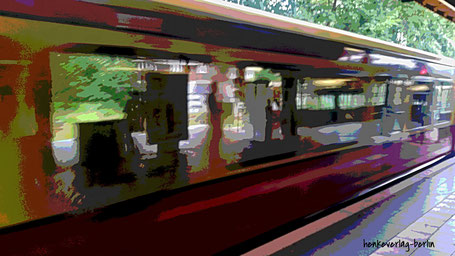
Letztens fuhr ich mal wieder S-Bahn. Ganz gegen meine Gewohnheit hatte ich an diesem Tag während der Fahrt weder ein Buch zur Hand, noch Musik im Ohr. Ich suchte mir einen Sitzplatz in einer der langen vor den Fenstern befindlichen durchgehenden Sitzbänke, so dass ich meine Zeit damit vertreiben konnte, die mir auf ebenso einer länglichen durchgehenden Bank gegenübersitzenden Fahrgäste zu beobachten. Dort saßen mehrere junge Männer im Alter zwischen Mitte zwanzig und Ende dreißig und eine ältere Dame. Während die ältere Dame freundlich in der Gegend umherschaute, waren die Herren alle mit Ihren Mobiltelefonen beschäftigt und schauten, wenn überhaupt, nur kurz auf, um, so hatte es den Anschein, zu orten, an welcher Station sie sich befanden. Neben mir bot sich das gleiche Bild; allerdings befanden sich auf meiner Seite auch weibliche Wesen, die sich mit ihren Mobiltelefonen beschäftigten.
An einer der nächsten Stationen stiegen ein Junge und ein kleines Mädchen hinzu. Das kleine Mädchen ergatterte fröhlich den letzten freien Sitzplatz zu meiner Linken und strahlte ihren Begleiter (bei dem es sich aufgrund der äußerlichen Ähnlichkeit durchaus um ihren Bruder handeln durfte) an. Wir waren nun sozusagen Sitznachbarn. Ich musterte meine neue Sitznachbarin. Sie war ungefähr vier Jahre alt, hatte schwarzes lockiges kinnlanges Haar. Sie saß auf der Sitzbank und ihre Füße baumelten in der Luft. Ihre Kleidung sah danach aus, dass sie einem Waschmaschinengang nicht abgeneigt gewesen wären und ihre Füße steckten in Badelatschen, die schon bessere Tage gesehen hatten. Auch die kleinen Füße hätten sich sicher über ein schönes Fußbad mit anschließender Pediküre gefreut.
Während ich das Mädchen amüsiert musterte, trafen sich unsere Blicke und sie schaute mich neugierig, aber freundlich mit ihren großen dunklen Augen an. Danach wanderte ihr Blick zu ihrem vermeintlichen Bruder, der an der Tür stehen geblieben war und zu ihr hinüber lächelte. Die ältere Dame schaute freundlich meine neue Sitznachbarin an, ansonsten hatte sich bezüglich der Handyaktivitäten auf der gegenüberliegenden Seite nichts verändert.
Nach einer Weile begann das kleine Mädchen leise und zaghaft vor sich hin zu singen. Es war so leise, dass ich mir zunächst nicht sicher war, ob es Einbildung war oder ich tatsächlich eine Mädchenstimme hörte. Ich schaute sie von der Seite an und sie wandte sich mir zu und erwiderte meinen Blick, wobei ich das Gefühl hatte, dass ihr zaghafter Gesang unter meinem Blick noch zaghafter wurde. Daraufhin lächelte ich sie aufmunternd an. Zögerlich erwiderte sie mein Lächeln und setzte ihren Gesang nun etwas lauter fort. Als ich sie weiterhin aufmunternd anlächelte, fasste sie ihren Mut zusammen und sang noch lauter. Sie sang in einer Sprache, die mir fremd war und ihre Stimme war dünn aber melodisch. Unter meinem Lächeln begann sie dann ebenfalls zaghaft im Takt zu klatschen und als die ältere Dame auf der gegenüberliegenden Seite sie ebenfalls anlächelte, wurde sie noch mutiger und ihr Gesang und das Klatschen noch lauter. Von den Herren auf der gegenüberliegenden Bank sah einer nach dem anderen erst kurz, ja fast irritiert suchend, von ihren Handys auf, um den Ursprung der singenden Geräuschkulisse auszumachen. Als der Ursprung des Gesanges ausgemacht war, widmeten sie sich dann alle wieder ihren Handys, um dann nach ein paar Sekunden erneut hochzuschauen. Nach und nach wurde die Kleine von den Herren von der anderen Seite mit ernster und mehr oder weniger ausdrucksloser Miene gemustert, was sie zunächst irritierte, so dass ihr Gesang und ihr Klatschen wieder zaghafter wurden.
Ihr Blick wanderte dann zunächst zu ihrem Bruder und dann zu mir. Wir lächelten ihr weiterhin aufmuntert zu, so dass ihr Gesang und ihr Klatschen an Lautstärke wieder zunahmen. Es dauerte noch eine S-Bahnstation, dann ließ ein Fahrgast nach dem anderen von seinem Handy ab und alle (auch die Fahrgäste auf meiner Seite) schauten lächelnd zu dem fröhlichen singenden und klatschenden Mädchen. Die Fahrgäste tauschten sogar untereinander amüsierte Blicke aus und lächelten sich dabei an.
Es war ein schöner Moment zu beobachten, wie die Mitmenschen sich offensichtlich nun alle wahrnahmen und davon abließen, sich mit sich und ihren Handys zu beschäftigen und ich hatte fast den Eindruck, dass sie –wenn ihnen der Text und die Melodie des Liedes bekannt gewesen wären – mitgesungen hätten. Die ältere Dame auf der gegenüberliegenden Bank begann dann, in dem von der Kleinen vorgegebenen Rhythmus mitzuklatschen und der vermeintliche Bruder tat es ihr nach.
Leider musste ich an der darauf folgenden Station den Zug verlassen. Meine Fahrt endete dort. Was blieb, war ein Lächeln auf meinem Gesicht und ein gutes Gefühl, gerade erlebt zu haben, dass wir Menschen doch noch in der Lage sind, auf einander einzugehen und uns wahrzunehmen. In der ach so schnelllebigen Zeit kurz innezuhalten und dem Gesang eines kleinen Mädchens in der S-Bahn zu lauschen und uns an deren Fröhlichkeit zu erfreuen. Eine Fröhlichkeit, die –ihrem äußeren Erscheinungsbild nach – nicht von Markengarderobe und dem damit einhergehenden Konsumüberfluss geprägt war. Sie schien so frei von all diesen Oberflächigkeiten und – in diesem Moment zumindest- glücklich.
Wenn Ihr das nächste Mal unterwegs seid, schaut von Eurem Buch oder Handys einfach mal hoch, nehmt die Musik aus dem Ohr… es lohnt sich.
Claudia Lekondra
Das Leben beginnt dort, wo die Angst endet

Das Leben beginnt dort, wo die Angst endet…
Im Zusammenhang mit den uns ständig erreichenden abschreckenden Nachrichten von Attentaten ist es doch genau das, worum es geht; dass wir es nicht zulassen dürfen, dass Ängste unser Leben beherrschen. Dass wir es nicht zulassen, dass diese Schreckensnachrichten uns die Freude am Leben nehmen. Dass wir nicht vergessen, wie schön die Welt eigentlich ist, auf der es uns vergönnt ist zu leben. Dass es neben all diesen schrecklichen Ereignissen doch auch so viel Gutes gibt und dass die anderen in der Minderzahl sind.
Dass wir nicht verlernen, allem erst einmal positiv zu begegnen, ohne dabei die Objektivität zu verlieren. Dass wir uns nicht einfangen lassen von denen, die diese Ereignisse nutzen, Vorurteile zu schüren und Untergangsszenarien aufzuzeigen.
Wir leben in einer freien Gesellschaft, die es uns ermöglicht, unser eigenes Urteil zu bilden und unseren Vorlieben zu folgen. Wir haben den Luxus, dass uns von Kindesbeinen an der Weg zur Schuldbildung geebnet wird, also sollten wir unsere Bildung auch nutzen und müssen diejenigen sein, die für diese Gesellschaftsform, in Freiheit zu leben, einstehen und sich jeden Tag aufs Neue vor Augen führen, dass genau diese Art und Weise, wie wir leben dürfen, für viele Menschen eben nicht Normalität ist .
Es werden täglich weltweit mehr gesunde als kranke Kinder geboren. Der medizinische Fortschritt ermöglicht es, dass die meisten kranken Menschen wieder gesund werden, dass die Lebenserwartung in unseren Breitengraden ansteigt. Dass dem Regentag ein Sonnentag folgen wird…
Egal ob und welcher Religion wir angehören, dürfen wir den Glauben an das Gute nicht verlieren und es uns von einer handvoll Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, uns, unsere Werte und Lebensweise als ihr Feind betrachten, nicht nehmen lassen, in Freiheit zu leben.
Ich will weder mein Lachen und meine Freude noch meine Freiheit verlieren, ich will sie nicht gewinnen lassen, die anderen. Um es mit den Worten des französischen Journalisten Antoine Leiris zu sagen, der seine Frau bei den Anschlägen in Paris letzten November verlor: Meinen Hass bekommt ihr nicht!
Und unsere Angst bekommen sie auch nicht, denn wir wollen leben: In Freiheit!
Claudia Lekondra
Die Freiheit unserer Gesellschaft und was der Fußball damit zu tun hat…

Eine Woche vor dem Finale der Europameisterschaft 2016 in Frankreich kann ich nicht anders und muss auch einmal über Fußball schreiben. Keine Sorge, ich werde an dieser Stelle nicht versuchen zu fachsimpeln, hierbei könnte ich eh nur gegen all die Hobbyfußballexperten verlieren. Zunächst muss ich mich outen: ich bin Fußballfan der deutschen Nationalmannschaft und das nicht erst seit 2006, sondern bereits seit meiner Teenagerzeit. Ich habe nicht einmal die Ausrede, das kam, was kommen musste, von wegen ich wurde seitens meines Elternhauses oder sonstigen Familienmitgliedern dahingehend geprägt, mich bei Fußballtunieren, ob nun Europa- oder Weltmeisterschaften, vor dem Fernseher einzufinden und mit dem deutschen Team mitzufiebern. Weder meine Eltern, noch ein anderes Familienmitglied konnten sich dafür begeistern, den Herren in kurzer Hose neunzig Minuten (oder auch länger) zuzuschauen. Also saß ich allein vor dem Fernseher. Damals gab es weder ein Public Viewing, zu dem ich hätte gehen können und es war damals auch nicht üblich, jedes Fußballspiel während einem Turnier zum Anlass zu nehmen, mit Freunden gemeinsam das Spiel zu schauen.
Einzige Ausnahme: Das WM Finale 1990; Deutschland gegen Argentinien.. Ich urlaubte damals in Griechenland und hatte die Ehre und das Vergnügen, neben deutschen und englischen Urlaubsgästen mit fußballbegeisterten Griechen (die waren natürlich für das deutsche Team) das Endspiel gemeinsam in der Hotelhalle am Strand auf Korfu zu verfolgen. Wie die Partie ausging, ist hinlänglich bekannt. So endete dieser Abend ouzolastig und sirtakitanzend und ich hatte mit den fröhlichen Griechen an meiner Seite fast das Gefühl, als habe Griechenland die WM gewonnen. Jahre später konnte ich mich dann für die griechische fußballbegeisternde Gastfreundschaft revanchieren und fieberte beim EM Endspiel 2004 gemeinsam mit den Griechen in einem griechischen Lokal in Berlin mit. Allerdings war der Abend nicht annähernd so ouzolastig, wie 1990 und Sirtaki wurde auch nicht getanzt.Das waren meine ersten Erlebnisse mit Public Viewing.
Ich begegnete dann tatsächlich Gleichgesinnten oder zumindest Leuten, die Freude am geselligen fröhlichen Beisammsein anlässlich eines Fußballspiels während eines EM oder WM Turniers fanden. Und spätestens seit 2006 sind diese Zusammenkünfte eine Selbstverständlichkeit. Ach, was ist es schön, innerhalb dieser Tunierzeiten regelmäßig auf die Freunde zu treffen. Gelingt es einem doch sonst kaum, in dieser Regelmäßigkeit mal so kurz zum Fernsehschauen sich zusammenzufinden. Es ist halt Ausnahmezustand!
Und all den Fußballgegnern, jenen, die sich genervt fühlen, die das alles für affig halten, die kopfschüttelnd die mit Deutschlandfarben bemalten Menschen und geschmückten Autos betrachten, die sich stundenlang darüber auslassen, dass man nicht verstehe, was man daran finde, dass 20 Männer hinter einem Ball her hetzen, die den Hype und die Begeisterung so gar nicht teilen, sei gesagt: die gute Nachricht ist: nächsten Sonntag ist alles wieder vorbei, die schlechte Nachricht: die nächste WM steht bereits in zwei Jahren an.
Egal ob man sich nun dafür begeistern kann oder nicht, sollten wir gerade im Hinblick auf die jüngsten Anschläge in Istanbul und in Dhaka zusammenhalten und während eines solchen Turniers die Möglichkeit nutzen, ein Zeichen über Landesgrenzen hinaus zu setzen, indem die einen es sich nicht nehmen lassen, mit Freude und Spaß den Jungens aus Europa dabei zuzusehen, wie sie mit Leidenschaft und Herzblut dem Ball hinterherlaufen und die anderen dieser Begeisterung statt mit einem Kopfschütteln vielleicht mit einem nachsichtigen Lächeln begegnen und wir so gemeinsam für die Freiheit in unserer Gesellschaft einstehen . Die Freiheit, selber zu entscheiden, ob und wie man mit so unwichtigen Dingen wie einem internationalen Fußballtunier umgeht: Ignorieren oder daran erfreuen…jeder entscheidet für sich und akzeptiert die Entscheidung des anderen, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Claudia Lekondra
Und nichts die Stunde uns wiederbringen kann... ein Lebensgefühl vergangener Zeiten...

Ein Jahr Zeit hat die Überarbeitung meines Erstlingswerkes „Und nichts die Stunde uns wiederbringen kann“ gedauert und nun steht die Veröffentlichung kurz bevor. Jener Roman, der zwar im Jahr 2002 veröffentlicht wurde, aber dessen ersten Zeilen bereits Anfang der Neunziger zu Papier gebracht wurden.
Warum kommt man auf die Idee, einen Roman, der vor nunmehr vierzehn Jahren veröffentlicht wurde, zu überarbeiten und in einem neuen Gewand herauszubringen? Das fragt sich sicher der eine oder andere.
Wie so oft im Leben kann man eben nicht alles mit Logik erklären. Es war mir einfach ein Bedürfnis, es war ein Gefühl, dass ich es der Geschichte schuldig bin, sie noch einmal in Form zu bringen, nachdem die erste Printversion nicht dem entsprach, was ich mir vorstellte. Habe ich doch gerade diesen Roman, der als erstes veröffentlicht wurde, als mein Herzblut angesehen.
Beim Überarbeiten der Geschichte fühlte ich mich in diesem Empfinden mehr als bestätigt. Es war eine tolle Erfahrung, einer Geschichte, die man einst Anfang der Neunziger begann zu schreiben, wieder so nah zu sein.
Es ist die Geschichte der Jugend der 80er. Sie suchten nach der perfekten Welt, wie alle jungen Menschen jeder Generation es taten. Damals war die Welt noch getrennt in Ost und West. Um über die Grenzen der Länder miteinander in Kontakt zu bleiben, schrieb man sich Briefe, so ganz altmodisch auf Papier. Man steckte das Blatt Papier in einen Briefumschlag, klebte eine Briefmarke drauf und warf den Brief in einen Briefkasten. Dann wartete man Wochen auf eine Antwort. Telefonieren über die Ländergrenzen hinaus gehörte damals noch zum Luxus. Nicht wie heute, wo man den Internetzugang und die damit gebotenen Plattformen zum Telefonieren über die Landesgrenzen, ja sogar über Kontinente hinaus nutzt.
Eine Zeit ohne Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp und wie sie alle heißen. Heutzutage ist es ein leichtes, mit vielen Leuten – wenn es dann gewollt ist – in Kontakt zu bleiben. Damals war es schon eine Herausforderung, mit verschiedenen Leuten über die Landesgrenze in Verbindung zu bleiben. Diente zur Kommunikation meist eben nur der bereits schon erwähnte Briefaustausch und vielleicht mal ein Telefonat. Damals war man nicht ständig im Bilde darüber, wo die anderen gerade waren, was man gerade tat, welchen Trends man folgte. Keine fotografischen Selbstdarstellungen, keine Offenlegung der Privatsphäre. Für manche ist diese Welt des Social Networks ein Fluch, für andere ein Segen. Aber jeder kann für sich entscheiden, wie und ob man diese Plattformen nutzt.
Die Welt ist im einundzwanzigsten Jahrhundert anderen Bedrohungen ausgesetzt und die Jugend von heute wächst damit auf und lernt damit umzugehen, so wie wir damals mit der Trennung Europas in Ost und West aufwuchsen.
Beim Überarbeiten des Romans ist mir bewusst geworden, dass es sich bei dieser Geschichte ein Stück weit um ein Zeitdokument der 80er Jahre handelt, und dass Romane ein Lebensgefühl vergangener Zeiten zum Leben erwecken können.
Immer wieder bin ich von Lesern angesprochen worden, ob ich nicht einen Fortsetzungsroman schreiben würde. Als die Überarbeitung des Romans abgeschlossen war, habe ich lange darüber nachgedacht, ob die Geschichte weitergehen könnte. War doch für mich die Geschichte, so wie sie damals endete, erzählt.
Einen Fortsetzungsroman zu schreiben kam für mich nicht in Frage, aber irgendwie war es auch für mich nicht uninteressant, mir die beiden Hauptfiguren des Romans ,Pia und Felizitas, in der heutigen Welt vorzustellen…und so entstand ein weiteres Kapitel..coming out soon.
Claudia Lekondra
D A N K E!

Ich möchte diesen Monat die Gelegenheit nutzen, um einmal Danke zu sagen. Danke an die Leser und Leserinnen, die mir schreiben und mich teilhaben lassen an ihren Gedanken und Empfindungen, wenn sie meine Zeilen lesen. Das Autorendasein fühlt sich manchmal einsam an. Man sitzt allein am Schreibtisch vor dem Computer. Die Gedanken und Gefühle formen sich zu Worten und Geschichten und das Schreiben erfüllt einen, aber der Austausch über das, was in einem vorgeht, findet in diesen Momenten nicht statt. Man ist für sich mit dem, was man sagen und zum Ausdruck bringen möchte, mit dem, was einen bewegt. Und dann erreichen mich Eure Nachrichten und es fühlt sich für mich so gut an, auf diesem Weg zu erfahren, dass Ihr irgendwo da draußen seid. Deshalb möchte ich an dieser Stelle Eure Feedbacks zu meinen monatlichen Blogs mit den anderen Lesern teilen. Wenn Ihr schreibt, dass Euch der Blog über die eigene Umgehensweise mit dem Leben anregt, dass ich Euch, mit dem was ich schreibe total aus dem Herzen spreche, wenn Ihr Euch bedankt für meine Worte und mich wissen lasst, dass sie so wahr sind, dass die Geschichte über den Obdachlosen und der Tasse Kaffee Euch berührt. Wenn Ihr schreibt, dass ich so weiter machen soll, weil meine Worte die Welt für diesen Moment ein klitzekleines bisschen besser machen, berührt Ihr mich und das ist Motivation pur! DANKE!
Claudia Lekondra
P.S.: Für die, die anfragten, was mein Buchprojekt macht: Es ist inhaltlich vollendet. Hierzu mehr im nächsten Blog.
Today is life, tomorrow never comes…

Today is life, tomorrow never comes…
dieser Satz prangt auf einer Mauer direkt am Meeresufer von Matala, dem einstigen Hippiedorf der sechziger und siebziger Jahre im Süden der griechischen Insel Kreta. Geschrieben wurde dieser Satz vor Jahrzehnten von einem griechischen Fischer. Der Fischer ist längst verstorben, er ist nicht besonders alt geworden, aber sein Satz ist geblieben.
Das Leben ist heute, ein Morgen wird es nicht geben! Immer mal wieder erreichen einen Nachrichten über den Tod eines Menschen, der viel zu früh aus seinem Leben gerissen wurde. Die Nachricht über den Tod eines Menschen, ob man ihn nun privat kannte oder er eine Person des öffentlichen Lebens war, erschüttert, auch wenn der Mensch im gesegneten Alter aus dem Leben scheidet, aber immer wenn es um Menschen geht, die aus dem Leben scheiden und eben kein gesegnetes Alter erreichen durften, stimmt es einen besonders nachdenklich.
So letzte Woche zum Beispiel die Nachricht über den plötzlichen und unerwarteten Tod von Roger Cicero. 45 Jahre, ein Alter bei dem noch keiner ans Sterben denkt, ein Alter, wo man glaubt mitten im Leben zu stehen. Dieses Gefühl, dem man sich nicht entziehen kann, dass diese Menschen um etwas betrogen wurden. Um einen Teil ihres Lebens.
Auch ich musste mich in meinem Leben von Menschen verabschieden, die viel zu früh aus dem Leben gingen und wenn einen eine solche Nachricht erreicht, ist man ihnen wieder ganz nah.
Man fragt nach dem „Warum“ und wird nie eine Antwort erhalten. Was für einen selber bleibt, ist das Bewusstsein, dass das Leben nicht unendlich ist und dass man Dinge, die einem wichtig sind, nicht aufschieben, sondern umsetzen, leben, fühlen und auch begreifen sollte. Das Leben ist zu kostbar, um es mit Dingen zu füllen, die einem nichts bedeuten. Man hält inne und nimmt sich vor, bewusster zu leben, mehr Zeit mit den Menschen und Dingen zu verbringen, die einem wirklich wichtig sind im Leben.
Aber man weiß auch, dass der Alltag diese Gedanken und diese guten Vorsätze oft wieder in den Hintergrund drängt. Dabei sind wir es den Menschen, die viel zu früh gehen mussten, schuldig. Wir sind es ihnen schuldig, inne zu halten und ein Stück weit ihr Leben mit zu leben.
Als ich letztes Jahr am Strand von Matala lag, hatte ich jeden Tag den Satz des griechischen Fischers vor Augen: Today is life, tomorrow never comes! Und jeden Tag kam diese Botschaft aufs Neue bei mir an und als ich abreiste, da hatte sie sich in die Tiefe meines Bewusstseins verankert.
Claudia Lekondra
Der Tag, an dem eine Kaffeetasse und ein Stuhl so viel mehr waren...

An einem ungemütlichen kalten Märztag stand ich in Berlin fröstelnd an der Haltestelle. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich eine Videothek und ich betrachtete interessiert die Schaufenster. Während diese sonst schmucklos gestaltet waren und einem lediglich einen Einblick in die Räume der Videothek gewährten, waren sie an diesem Tag mit mehreren Fernsehern ausgestattet, auf denen alle der gleiche Film gezeigt wurde. Gedankenversunken verfolgte ich die Filmszenen, als ich einen Mann bemerkte, der vor der Videothek stehen blieb und die wechselnden Bilder auf den Bildschirmen betrachtete. Ich stand auf der anderen Straßenseite etwas seitlich versetzt, so dass ich das Profil des Mannes von meiner Position aus sehen konnte. Bei dem Mann handelte es sich um einen der Obdachlosen unserer Stadt, den ich vom Sehen kannte.
Und während ich dort so stand und die Szene auf mich wirken ließ, wie der obdachlose Mann, bekleidet mit Jeans und Anorak, seine Habseligkeiten neben sich in einem Einkaufswagen platziert, mit diesem Lächeln im Gesicht und offensichtlicher Freude die für ihn tonlosen Bilder im Schaufenster verfolgte, trat ein junger Mann aus der Videothek. Er war nur mit einem Pulli bekleidet und sprach den Mann vor dem Schaufenster an.
Dieser schaute irritiert und schüttelte dann den Kopf. Daraufhin verschwand der junge Mann wieder in der Videothek, um kurze Zeit später wieder mit einem Stuhl in der einen und einer Kaffeetasse in der anderen Hand herauszutreten. Er stellte den Stuhl vor das Schaufenster und reichte ihm den Kaffee.
Zögerlich griff er nach der Tasse. Der junge Mann verschwand wieder in der Videothek und ließ ihn vor dem Schaufenster mit der Kaffeetasse in der Hand, dem Stuhl neben sich und seinen Habseligkeiten im Einkaufswagen zurück.
Während er das Geschehen auf den Bildschirmen weiter verfolgte, wärmte er seine Hände an der Tasse und nippte an dem Kaffee.
Nach einer Weile setzte er sich auf den Stuhl und es schien, als hatte er seine Umgebung, die Straße, den Bürgersteig, die ungemütlichen Temperaturen, ja selbst die Tatsache, dass ein Schaufenster ihn vom Geschehen auf den Bildschirmen trennte, vergessen. Er wirkte versunken in die tonlosen bunten Bilder und ich stand auf der gegenüberliegenden Seite und fühlte mich von dieser Szene berührt.
Längst war mein Bus an mir vorbei gefahren und ich stand immer noch dort und schaute zu dem Mann hinüber. Der Obdachlose, der aus unserer gesellschaftlichen Mitte längst ausgegrenzt war, berührte mich in diesem Moment auf eine Art und Weise, dir mir noch nach all den Jahren so gegenwärtig ist.
Er wirkte in diesem Moment zufrieden und glücklich. Dort auf diesem Stuhl, mit der Kaffeetasse in der Hand wirkte er in diesem Augenblick glücklicher, als die Menschen, die an ihm vorbei hasteten. Menschen, die ein Dach über den Kopf hatten, dass sie ihr zu Hause nennen durften, die in ihrer Position in unserer gesellschaftlichen Mitte akzeptiert waren, die aber vielleicht verlernt hatten, sich an den Kleinigkeiten, den scheinbar unwichtigen Dingen in unserem Leben, zu erfreuen. Die so viel forderten, so viele benötigten, um das Gefühl des Glücklich seins zuzulassen.
Und er saß dort, auf der anderen Straßenseite und ließ den Augenblick zu und der junge Mann, der ihm den Stuhl hinstellte und die Kaffeetasse überreichte, führte mir vor Augen, dass da Menschen unter uns waren, die Wärme und Geborgenheit an einem ungemütlichen Märztag auf dem Bürgersteig mitten in Berlin ermöglichten und das einem Fremden, ja sogar einem Obdachlosen gegenüber.
Wenig kann manchmal so viel sein, Mensch sein oftmals so einfach.
Seit jenem Tag sind mehr als zehn Jahre vergangen.
Die Videothek existiert noch heute und jedes Mal, wenn ich an dem Laden vorüber gehe, denke ich an den Obdachlosen und den jungen Mann und daran, wie an jenem ungemütlichen Tag im März eine Kaffeetasse und ein Stuhl die Welt ein Stück in die richtige Richtung bewegten.
Claudia Lekondra
Auf dem Weg zur Selbstreflexion

Wir befinden uns im Informationszeitalter. Unser Wissen und unsere Kenntnisse nehmen ständig zu. Im Internet, in Fernsehsendungen, in der Presse und über Fachbücher suchen wir nach Fakten über den Menschen als Gegenstand. Dort erfahren wir beispielsweise eine Menge über unseren Körper, Arzneimittel, Nahrungsmittel, sportliche Übungen etc.
Über das, was uns persönlich ausmacht, erfahren wir nichts.
Um uns selbst wahrzunehmen, müssen wir unsere Veranlagungen, unsere Erfahrungen und unser Verhalten anderen Menschen gegenüber reflektieren. Wir müssen die Reaktion der Umwelt auf unser Verhalten verstehen. Nur über die Selbstreflexion ist es uns möglich, uns selbst zu erkennen.
Wir müssen uns bewusst machen, was uns wichtig ist, was uns glücklich macht und lernen, aus der Fülle der Möglichkeiten das auszuwählen, was uns gut tut. Wir müssen lernen zu erkennen, wenn sich unsere Vorstellungen und Bedürfnisse ändern. Gerade in unserem schnelllebigen hektischen Alltag besteht die Gefahr, dass man die Veränderung der Bedürfnisse nicht wahrnimmt, weil keine Zeit zum Innehalten bleibt. Diese Zeit, diese Momente des Innehaltens muss man sich ganz bewusst schaffen.
Manchmal erwischt man sich dabei, dass einen mitunter alltägliche Entscheidungen, beispielsweise die Auswahl des Brotes (Dreikornbrot, Vierkornbrot, Fünfkornbrot, Dinkelbrot, Gerstenbrot, Haferbrot, Hirsebrot, Maisbrot, Buchweizenbrot, eiweißarmes Brot, glutenfreies Brot etc.) zeitweilig überfordern.
Wir lernen, fremdbestimmt zu reagieren. In der Schule bestimmt der Lehrer, zu Hause die Eltern und bei der Arbeit der Chef. Heutzutage bestimmt auch der überfüllte Terminkalender über uns, da er uns dazu verleitet zusätzliche Termine aufzunehmen, wo Platz ist, und nicht da, wo man eigentlich möchte.
Erst wenn man weiß, wer man ist und was man braucht, um glücklich zu sein, kann man sich ein Leben schaffen, dass zu einem passt und einen erfüllt. Wenn man erkennt, dass man selber für den eigenen Misserfolg verantwortlich ist und nicht die anderen, wenn man akzeptiert, dass Negatives ebenso zum Leben gehört wie Positives.
Die Selbstreflexion ermöglicht es uns, unser Bewusstsein auf positive Dinge zu lenken, denn wir Menschen sind in der Lage unsere Aufmerksamkeit zu steuern. Doch wenn man nicht weiß, worauf man seine Aufmerksamkeit lenken möchte, dann landet irgendwas in unserer Wahrnehmung und vermutlich sind das nicht unbedingt Dinge, die glücklich machen.
Seitdem ich regelmäßig über meinen Tag reflektiere und dabei feststelle, was mir guttut und was nicht, hole ich mir mehr von den guten Dingen in meinen Alltag. Und was diese Dinge sind, verrate ich hier vielleicht ein anderes Mal.
Claudia Lekondra
Wir haben nur drei Sekunden für die Gegenwart…
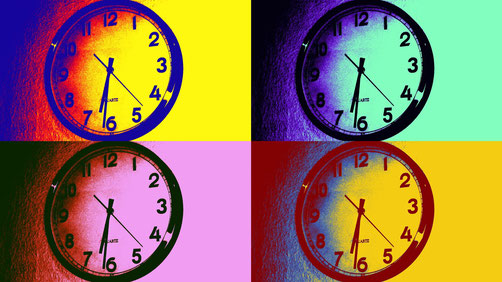
Zum Jahreswechsel hört man ständig Sätze wie: Mein Gott ist das Jahr wieder schnell vergangen. Wo ist nur die Zeit geblieben? War nicht eben erst Januar 2015, haben wir nicht gerade erst Weihnachten gefeiert …
Aussagen, die die meisten zunächst sofort bestätigen würden. Aber wenn man sich die Zeit nimmt und in Ruhe einmal das Jahr 2015 passieren lässt, es einfach mal Monat für Monat gedanklich durchgeht, wird man feststellen, wo die Zeit geblieben ist und dass Januar 2015 nicht eben erst war.
Da waren Reisen in andere Länder, neue Eindrücke, die man gewonnen hat. Schöne Momente mit Freunden, interessante Gespräche, persönliche Erfolge (oder leider auch Misserfolge). Geburtstage, Partys, Hochzeiten, Trauer, Fassungslosigkeit, Wut, Freude, Spaß, Liebe. Und dann waren da noch die Begegnungen mit Menschen, die unser Leben bereicherten, manchmal unseren Blickwinkel veränderten. Als aus Fremden Bekannte wurden und aus Bekannten Freunde…
Dennoch bleibt es bei dem Empfinden, dass das Jahr schnell vergangen ist und man sich fragt, wo die Zeit geblieben ist.
Sicher liegt diese Wahrnehmung daran, dass wir von der Zeit nur Notiz nehmen, wenn sie vorbei ist. Vielleicht sollten wir uns zum Anfang eines neuen Jahres vornehmen, sorgsamer mit unserer Zeit umzugehen. Die äußere Zeit ist gebunden an den Lauf der Erde um die Sonne; ein Tag besteht aus vierundzwanzig Stunden, fertig.
Unsere innere Zeit jedoch ist eng gebunden an unsere Wahrnehmung der Gegenwart und diese sitzt zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Kaum ist die Gegenwart in unser Bewusstsein getreten, ist sie schon wieder Erinnerung. Man hat herausgefunden, dass die Gegenwart etwa drei Sekunden lang dauert. Drei Sekunden haben wir für das „Jetzt“, in der vierten Sekunde ist es bereits Vergangenheit.
Ob das Jahr 2015 nun schnell oder weniger schnell vergangen ist, unterliegt der persönlichen Wahrnehmung eines jeden. Wichtig ist, dass wir versuchen, die Zeit sinnvoll zu nutzen, denn wir haben nur drei Sekunden für die Gegenwart. In diesem Sinne: Happy 2016!
Claudia Lekondra